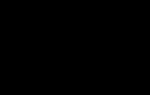Was ist Pharmakovigilanz, regulatorische Dokumente, regulatorische Maßnahmen? Was ist Pharmakovigilanz, regulatorische Dokumente, regulatorische Maßnahmen? Regeln der guten Pharmakovigilanz-Praxis der EAWU
Gesundheitsministerium der Russischen Föderation
Situationsaufgabe Nr. 5
Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung führt eine obligatorische nicht-interventionelle Studie des Arzneimittels „PV“ im klinischen Alltag bei Patienten mit arterieller Hypertonie und gleichzeitiger Diagnose einer Pyelonephritis durch. Die geschätzte Stichprobe beträgt 220 Personen. Laut Protokoll beträgt der festgelegte Zeitraum für die Durchführung der Studie 1 Jahr. Ziel der Studie war es, die Sicherheit des Arzneimitteleinsatzes im klinischen Alltag bei Patienten mit gleichzeitiger Diagnose einer Pyeloniphritis zu bewerten. Welche grundlegenden Unterlagen müssen der zuständigen Aufsichtsbehörde für den gesamten Studienzeitraum vorgelegt werden?
Situationsaufgabe Nr. 6
An klinischen Studien nehmen 20 Personen beiderlei Geschlechts im fruchtbaren Alter teil. Welche Aktivitäten müssen in einem Präventionsprogramm geplant werden?
Situationsaufgabe Nr. 7
Bei der Überwachung des Arzneimittels nach dem Inverkehrbringen wurde ein neues Sicherheitsproblem festgestellt. Die nationalen Aufsichtsbehörden haben den jeweiligen Zulassungsinhaber darüber informiert, dass beschlossen wurde, dieses Arzneimittel in die Liste der Arzneimittel aufzunehmen, die einer zusätzlichen Überwachung unterliegen. Was muss der Zulassungsinhaber in diesem Fall tun?
Situationsaufgabe Nr. 8
Der Zulassungsinhaber hat eine Mitteilung von einem Arzt eines Patienten erhalten, der an der klinischen Studie WW-3-33 teilnimmt. Der Bericht bezieht sich auf die Entwicklung einer unerwünschten Reaktion bei einem Patienten auf das Medikament WW, das von Inhabern einer Marktzulassung hergestellt wurde. Ist diese Nachricht spontan?
REZENSIONEN UND ORIGINALARTIKEL
Das Risikomanagementsystem ist ein wichtiger Bestandteil der guten Pharmakovigilanz-Praktiken (GPR).
A. S. Kazakov, K. E. Zatolochina, B. K. Romanov, T. M. Bukatina, N. Yu. Velts
Föderale Staatshaushaltsinstitution „Wissenschaftliches Zentrum für medizinische Produkte“ des Gesundheitsministeriums der Russischen Föderation, 127051, Moskau, Russland
Der Artikel ist am 10. Dezember 2015 eingegangen. Zur Veröffentlichung angenommen am 17. Dezember 2015.
Zusammenfassung: Das Risikomanagementsystem umfasst den Prozess der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit einer unerwünschten Wirkung einer Pharmakotherapie, der Ermittlung des Ausmaßes und der Größe des Risikos, der Analyse und Auswahl einer Risikomanagementstrategie, der Auswahl der für diese Strategie erforderlichen Risikomanagementtechniken und der Möglichkeiten zur Reduzierung Es. Damit ist das Risikomanagementsystem eines der modernen und wirksamen Pharmakovigilanzinstrumente zur Steigerung der Wirksamkeit und Sicherheit der Pharmakotherapie.
Schlüsselwörter: Risikomanagementsystem, Nebenwirkung, Risikomanagementplan, Pharmakovigilanz.
Bibliografische Beschreibung: Kazakov AS, Zatolochina KE, Romanov BK, Bukatina TM, Velts NU. Das Risikomanagementsystem ist ein wichtiger Bestandteil der Regeln der Guten Pharmakovigilanzpraxis (GPR). Sicherheit und Risiko der Pharmakotherapie 2016; (1): 21-27.
Am 1. Januar 2016 tritt das Abkommen über gemeinsame Grundsätze und Regeln für den Drogenverkehr innerhalb der EAWU in Kraft. Im Rahmen dieser Vereinbarung ist es wichtig, dass die Aktivitäten des Herstellers den Anforderungen einer guten Pharmakovigilanzpraxis entsprechen.
Diese Regeln guter Pharmakovigilanz-Praxis basieren auf einer Reihe internationaler Standards, die die Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem von Organisationen und Unternehmen beschreiben. Dies erfordert eine Standardisierung aller wichtigen Arbeitsaspekte, darunter auch des Risikomanagementsystems.
Risiko ist eine Kombination aus der Wahrscheinlichkeit und den Folgen des Auftretens erwarteter unerwünschter Ereignisse, die jemandem Schaden zufügen könnten.
Bei Arzneimitteln wird der Begriff „Risiko“ mit dem Begriff „Nebenwirkung“ gleichgesetzt.
Unter Risikomanagement versteht man den Prozess des Treffens und Umsetzens von Managemententscheidungen, die darauf abzielen, die Wahrscheinlichkeit eines ungünstigen Ergebnisses zu verringern und mögliche Schäden zu minimieren.
Es ist notwendig, die sogenannten wichtigen Risiken zu managen, also solche, die
haben einen erheblichen Einfluss auf das Nutzen-Risiko-Verhältnis und erhöhen den Risikoanteil in diesem Verhältnis.
Die Definition eines wichtigen Risikos hängt von mehreren Faktoren ab, darunter den Auswirkungen auf den einzelnen Patienten, der Schwere des Risikos und den Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung als Ganzes.
Informationen zu solchen Risiken sollten in den entsprechenden Abschnitten „Gegenanzeigen“, „Nebenwirkungen“ usw. der Gebrauchsanweisung für medizinische Zwecke enthalten sein.
Risiken, die im Allgemeinen nicht schwerwiegend genug sind, um besondere Warnungen oder Vorsichtsmaßnahmen zu rechtfertigen, aber bei einem großen Teil der untersuchten Bevölkerung auftreten, beeinträchtigen die Lebensqualität des Patienten und können schwerwiegende Folgen haben, wenn sie nicht angemessen behandelt werden (z. B. starke Übelkeit und Erbrechen). mit Chemotherapie oder einer anderen medikamentösen Therapie) können ebenfalls wichtige Risiken darstellen.
Bei einigen Arzneimitteln müssen die mit der Entsorgung des gebrauchten Arzneimittels verbundenen Risiken berücksichtigt werden (z. B. transdermale Pflaster).
Es kann auch vorkommen, dass bei der Entsorgung eines Arzneimittels aufgrund bekannter schädlicher Auswirkungen auf die Umwelt Umweltgefahren entstehen, beispielsweise bei Stoffen, die für Wasserlebewesen besonders gefährlich sind und nicht auf Mülldeponien entsorgt werden sollten.
Es können wichtige Risiken identifiziert werden (für die bestätigte Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen einem unerwünschten Ereignis und der Verwendung eines bestimmten Arzneimittels vorliegen) und potenzielle Risiken, bei denen der Zusammenhang eines unerwünschten Ereignisses mit einem bestimmten Arzneimittel nicht schlüssig nachgewiesen wurde.
Zu den wichtigen Risiken gehören auch wichtige fehlende Informationen – erhebliche Lücken im vorhandenen Wissen über bestimmte Aspekte der Sicherheit von Arzneimitteln oder Patientengruppen, denen Arzneimittel verschrieben werden.
Risikominimierungsaktivitäten sind eine Reihe von Maßnahmen, die darauf abzielen, ein unerwünschtes Ereignis im Zusammenhang mit der Exposition gegenüber Arzneimitteln zu verhindern oder deren Wahrscheinlichkeit zu verringern oder die Schwere eines unerwünschten Ereignisses, falls es auftritt, zu verringern.
Im GVP-Abschnitt „Risikomanagementsystem“ wird ein neuer Ansatz zum Risikomanagement vorgestellt, wonach das Hauptziel des Risikomanagements darin besteht, die Verwendung eines Arzneimittels bei größtmöglicher Überschreitung des Nutzens eines bestimmten Arzneimittels sicherzustellen ( oder eine Reihe von Arzneimitteln) über die Risiken für jeden Patienten und jede Zielgruppe. Dies kann entweder durch eine Erhöhung des Nutzens oder durch eine Verringerung der Risiken erreicht werden.
Der Risikomanagementprozess ist zyklisch und besteht aus sich wiederholenden Phasen der Identifizierung und Analyse von Risiken und Vorteilen, der Bewertung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses mit Ermittlung der Optimierungsmöglichkeiten, der Auswahl und Planung von Methoden zur Risikominimierung, der Umsetzung von Maßnahmen zur Risikominimierung und der Datenerfassung mit Überwachung die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen.
Der Risikomanagementprozess umfasst die folgenden Phasen:
Beschreibung des Sicherheitsprofils des Arzneimittels, einschließlich bekannter und unbekannter Aspekte;
Planung von Pharmakovigilanz-Aktivitäten zur Charakterisierung und Identifizierung von Risiken
Beseitigung neuer Risiken sowie Erhöhung des allgemeinen Wissensstandes über das Sicherheitsprofil des Arzneimittels;
Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Minimierung der Folgen von Risiken sowie Bewertung der Wirksamkeit dieser Maßnahmen.
Ein wichtiger Bestandteil des Risikomanagementsystems ist der Risikomanagementplan.
Ein Risikomanagementplan (RMP) ist eine detaillierte Beschreibung der Pharmakovigilanz-Aktivitäten, die darauf abzielen, mit Arzneimitteln verbundene Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu verhindern oder zu minimieren, einschließlich der Bewertung der Wirksamkeit dieser Aktivitäten.
Der PUR ist ein sich dynamisch veränderndes, unabhängiges Dokument, das über den gesamten Lebenszyklus des Arzneimittels aktualisiert werden muss und Informationen enthält, die folgende Anforderungen erfüllen müssen:
a) das Sicherheitsprofil von Arzneimitteln bestimmen und charakterisieren;
b) angeben, wie zur weiteren Charakterisierung des Arzneimittelsicherheitsprofils beigetragen werden kann;
c) Maßnahmen zur Verhinderung oder Minimierung von Risiken im Zusammenhang mit dem Drogenkonsum dokumentieren, einschließlich einer Bewertung der Wirksamkeit dieser Maßnahmen;
d) die Erfüllung der bei der Arzneimittelregistrierung eingeführten Nachregistrierungspflichten zur Gewährleistung der Anwendungssicherheit dokumentieren.
Um diese Anforderungen zu erfüllen, muss das RMP außerdem:
a) bekannte und unbekannte Informationen über das Sicherheitsprofil des Arzneimittels enthalten;
b) den Grad der Sicherheit angeben, dass die in klinischen Studien in den Zielpopulationen nachgewiesene Wirksamkeit des Arzneimittels in der täglichen medizinischen Praxis erreicht wird, und den möglichen Bedarf an Wirksamkeitsstudien in der Zeit nach der Zulassung dokumentieren;
c) eine Möglichkeit planen, die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Risikominimierung zu bewerten.
Die Struktur des RMP umfasst sieben Informationsteile:
Teil I „Arzneimittelübersicht“;
Teil II „Sicherheitsspezifikation“;
Teil III „Pharmakovigilanzplan“;
Teil IV „Plan für Wirksamkeitsstudien nach der Zulassung“;
Teil V „Maßnahmen zur Risikominderung (einschließlich Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Risikominderung)“;
Teil VI „Zusammenfassung des Risikomanagementplans“;
Teil VII „Anhänge“.
Wird der RMP für mehrere Arzneimittel erstellt, ist für jedes Arzneimittel ein eigener Teil bereitzustellen.
Der erste Teil des RMP „Übersichtsinformationen zum Arzneimittel“ sollte administrative Informationen zum RMP sowie Übersichtsinformationen zu dem Arzneimittel enthalten, für das der RMP erstellt wird. Dieser Abschnitt enthält Informationen:
Über den Wirkstoff (Wirkstoff, ATC-Code, Name des Inhabers der Marktzulassung, Datum und Land der weltweiten Erstzulassung, Anzahl der im RRP enthaltenen Arzneimittel);
Verwaltungsinformationen zum RMP (Enddatum der Datenerfassung innerhalb des aktuellen RMP; Einreichungsdatum und Versionsnummer; Liste aller Teile und Module des RMP mit Informationen zu Datum und Version des RMP, innerhalb derer die Informationen zuletzt aktualisiert wurden);
Informationen zu jedem im RMP enthaltenen Arzneimittel (Handelsname in den EAEU-Mitgliedstaaten; kurze Beschreibung des Arzneimittels, Indikationen, Dosierungsschema, Dosierungsformen und Dosierung, globaler Regulierungsstatus, aufgeschlüsselt nach Ländern (Datum der Registrierung/Ablehnung, Datum des Inverkehrbringens, aktueller Registrierungsstatus, erläuternde Kommentare).
Der Zweck des zweiten Teils der „Sicherheitsspezifikation“ des RMP besteht darin, einen kurzen Überblick über das Sicherheitsprofil des Arzneimittels zu geben, bekannte Sicherheitsinformationen anzugeben und Abschnitte des Profils zu identifizieren, für die die Sicherheit nicht ausreichend untersucht wurde.
Die Sicherheitsspezifikation sollte eine Zusammenfassung wichtiger Identifizierungen sein.
identifizierte Risiken des Arzneimittels, wichtige potenzielle Risiken und wichtige fehlende Informationen.
Die Sicherheitsspezifikation im RMP bildet die Grundlage des Pharmakovigilanzplans und des Risikomanagementplans.
Die Sicherheitsspezifikation im RMP umfasst acht Abschnitte (Module):
Modul I „Indikationsepidemiologie nach Zielgruppen“;
Modul II „Präklinischer Teil“;
Modul III „Arzneimittelexposition während klinischer Studien“;
Modul IV „Populationen, die nicht in klinischen Studien untersucht wurden“;
Modul V „Nutzungserfahrung nach der Registrierung“;
Modul VI „Zusätzliche Anforderungen an die Sicherheitsspezifikation“;
Modul VII „Erkannte und potenzielle Risiken“;
Modul VIII: Zusammenfassung der Sicherheitsthemen.
Die Sicherheitsspezifikation kann abhängig von den Eigenschaften des Arzneimittels, seiner Entwicklung und seinem Studienprogramm zusätzliche Elemente umfassen, einschließlich Qualitätsaspekten und deren Auswirkungen auf das Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil des Arzneimittels, dem mit der Freisetzungsform verbundenen Risiko und anderen Aspekten, die sich auf die Sicherheit auswirken Profil.
Der Zweck des dritten Teils des RMP, „Pharmacauvigilance Plan“, besteht darin, festzulegen, wie der Inhaber der Marktzulassung die in den Sicherheitsanforderungen genannten Risiken weiter identifizieren will.
Pharmakovigilanz-Aktivitäten werden in routinemäßige und zusätzliche Pharmakovigilanz-Aktivitäten unterteilt.
Unter routinemäßigen Pharmakovigilanzaktivitäten versteht man eine Reihe von Aktivitäten, die regelmäßig vom Inhaber des Registrierungszertifikats durchgeführt werden, um die Einhaltung der Anforderungen der Pharmakovigilanzgesetzgebung der EAWU-Mitgliedstaaten sicherzustellen.
Die Regulierungsbehörde eines Mitgliedsstaats der EAWU kann dem Inhaber der Marktzulassung eine Empfehlung zu Änderungen der aktuellen Verfahren zur Sammlung, Überprüfung, Bewertung und Meldung von Informationen über Nebenwirkungen aussprechen, die durch spontane Meldungen eingehen.
ny. In diesem Fall legt der Zulassungsinhaber eine Erläuterung der Änderungen der routinemäßigen Pharmakovigilanzaktivitäten vor, die gemäß den Empfehlungen der Regulierungsbehörde vorgenommen wurden.
Wenn der Zulassungsinhaber spezielle Fragebögen erstellen muss oder plant, diese zu verwenden, um strukturierte Informationen über identifizierte UAW von besonderem Interesse zu erhalten, sollten Kopien dieser Fragebögen im RMP-Anhang bereitgestellt werden.
Der Einsatz spezieller Fragebögen zur Nachverfolgung gemeldeter UAW-Verdachtsfälle gilt als routinemäßige Pharmakovigilanzmaßnahme.
Zusätzliche Pharmakovigilanz-Aktivitäten variieren in der Regel je nach den Sicherheitsproblemen, mit denen sie sich befassen.
Studien im Rahmen des Pharmakovigilanzplans müssen die in der Sicherheitsspezifikation genannten Sicherheitsbedenken berücksichtigen, unabhängig davon, ob die Studien auf die Identifizierung und Charakterisierung von Risiken oder die Bewertung der Wirksamkeit von Risikominderungsmaßnahmen abzielen.
Zu den weiteren Aktivitäten gehören Post-Marketing-Sicherheitsstudien, pharmakoepidemiologische Studien, pharmakokinetische Studien, klinische Studien oder zusätzliche präklinische Studien.
Studienprotokolle und Zusammenfassungen von Berichten aus Studien, die im Rahmen zusätzlicher Pharmakovigilanzaktivitäten durchgeführt wurden, sollten in einen Anhang zum RMP aufgenommen werden.
Der vierte Teil des RMP, „Planung von Post-Marketing-Wirksamkeitsstudien“, gilt ausschließlich für zugelassene Indikationen und nicht für Studien, die zusätzliche Indikationen untersuchen.
Als Erläuterung der vorgeschlagenen Wirksamkeitsstudien und um die Verfügbarkeit unterstützender Daten für die Aufnahme in den RMP sicherzustellen, enthält dieser Abschnitt zusammenfassende Informationen zur nachgewiesenen Wirksamkeit des Arzneimittels sowie einen Hinweis darauf, welche klinischen Studien durchgeführt wurden.
Diese Bewertung basiert auf Endpunkten und Bedingungen.
Im fünften Teil des RMP „Risikominderungsmaßnahmen“ muss der Zulassungsinhaber entsprechend der Sicherheitsspezifikation beurteilen, welche Maßnahmen zur Risikominimierung in Bezug auf den jeweiligen Sicherheitsaspekt erforderlich sind.
Der Risikominderungsplan sollte Einzelheiten zu den Risikominderungsaktivitäten enthalten, die durchgeführt werden, um die mit jedem identifizierten Sicherheitsproblem verbundenen Risiken zu reduzieren. Maßnahmen zur Risikominimierung können aus routinemäßigen Maßnahmen zur Risikominimierung (Anweisungen für den medizinischen Gebrauch; Kennzeichnung; Patienteninformation; Packungsgrößen; regulatorischer Status von Arzneimitteln) und zusätzlichen Maßnahmen zur Risikominimierung (Schulungsmaterialien) bestehen.
Der sechste Teil des RMP, „Zusammenfassung des Risikomanagementplans“, sollte die Kernelemente des RMP enthalten, mit besonderem Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Risikominimierung. Die Sicherheitsspezifikation des betreffenden Arzneimittels muss wichtige Informationen über erkannte und potenzielle Risiken sowie fehlende Informationen enthalten.
Dieser Abschnitt des RMP sollte die folgenden allgemeinen Informationen enthalten:
a) Überprüfung der Krankheitsepidemiologie;
b) allgemeine Daten zur Wirksamkeitsbewertung;
c) allgemeine Informationen zu Sicherheitsfragen;
d) zusammengefasste Informationen zu Maßnahmen zur Risikominimierung in Bezug auf jedes Sicherheitsproblem;
e) ein Entwicklungsplan nach der Zulassung (in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit), einschließlich einer detaillierten Beschreibung und Erläuterung aller Aktivitäten, die Voraussetzungen für den Erhalt einer Marktzulassung sind.
Der siebte Teil des RMP sollte Anhänge zum Risikomanagementplan enthalten.
Grundsätzlich müssen alle Teile des RMP vorgelegt werden. In einigen Fällen können jedoch im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einige Teile oder Module fehlen, es sei denn, die Verordnung enthält
Tabelle 1. Anforderungen an die Bereitstellung von Informationen zu Abschnitten des RMP bei der Einreichung eines Antrags auf eine Bescheinigung über die staatliche Registrierung der EU
Feedtyp ü ü > ü > ü > ü > ü > ü I > > > >
ьт Ё5 ЁО ЁО & ЁО ЁО Ei Ёо ь ь ь ь з
Biosimilar + - + + + + + + + + + + + +
Reproduzierte PM + + * * + * +
Ähnlicher Wirkstoff + + * * * + + + + + + + + +
Tabelle 2. Anforderungen an die Bereitstellung von Informationen zu Abschnitten des RMP bei der Einreichung eines Antrags auf eine Bescheinigung über die staatliche Registrierung der EAEC
Feedtyp ü ü > ü > ü > ü > ü > ü I > > > >
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
als Ch 53 53 53 53 53 53 53 53 als Stunde Stunde Stunde Stunde Stunde Stunde Stunde
Neuer Wirkstoff + + + + + + + + + + + + + +
Biosimilar + + + + + + + + + + + + + +
Reproduzierte PM + + + + * * + * +
Feste Kombinationen + + ± ± + + + + + + + + + +
Ähnlicher Wirkstoff + + * * + + + + + + + + + +
± – Kann in bestimmten Fällen fehlen; * - geänderte Anforderungen.
Weitere Vorgaben stellt die Regulierungsbehörde nicht dar.
Bei der Einreichung von Anträgen auf staatliche Registrierung sind die Anforderungen für die Übermittlung von Daten für Abschnitte des RMP in Tabelle 1 (EMA-Anforderungen) und Tabelle 2 (gemäß dem Entwurf der Regeln für gute Pharmakovigilanzpraxis der EAEC) aufgeführt.
Obwohl viele Experten an der Erstellung eines RMP beteiligt sein können, liegt die letztendliche Verantwortung für dessen Qualität, Genauigkeit und wissenschaftliche Integrität bei den Pharmakovigilanzbehörden in den EAWU-Mitgliedstaaten.
Der Inhaber der Marktzulassung ist für die Aktualisierung des RMP verantwortlich, sobald neue Informationen verfügbar werden.
Der Zulassungsinhaber muss außerdem dafür sorgen, dass das Einreichungsverfahren kontrolliert und dokumentiert wird.
RMP an die EAEU-Regulierungsbehörden unter Angabe der Einreichungsdaten und aller wesentlichen Änderungen, die an jeder Version des RMP vorgenommen wurden.
Diese Aufzeichnungen, das RMP und alle Dokumente im Zusammenhang mit Informationen innerhalb des RMP können von qualifizierten Pharmakovigilanz-Inspektoren überprüft werden.
Damit ist das Risikomanagementsystem eines der modernen und wirksamen Pharmakovigilanzinstrumente zur Steigerung der Wirksamkeit und Sicherheit der Pharmakotherapie.
LITERATUR
1. Leitlinie zu guten Pharmakovigilanzpraktiken (GVP) – Modul V (Rev 1) EMA/838713/2014 [Website]. URL: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2012/06/WC500129134. pdf.
2. Regeln der guten Pharmakovigilanz-Praxis (GVP), Ausgabe vom 6. November 2014 [Website]. URL: http://www.eurasi-ancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/oo/Pages/farmakanadzor.aspx.
3. Zu Änderungen des Bundesgesetzes „Über den Arzneimittelverkehr“ [Elektronische Ressource]: Feder. Gesetz Nr. 429-FZ vom 22. Dezember 2014 „Über Änderungen des Bundesgesetzes
„Zum Arzneimittelverkehr“ Zugriff aus dem Referenz- und Rechtssystem „ConsultantPlus“ (Zugriffsdatum 17.12.2015).
4. Über den Arzneimittelverkehr [Elektronische Ressource]: Federal. Gesetz vom 12. April 2010 Nr. 61-FZ (in der Fassung vom 22. Oktober 2014) „Über den Verkehr von Arzneimitteln“ // Russische Föderation. Gas. Nr. 78. 2010. 14. April. Zugriff aus dem Rechtsreferenzsystem „ConsultantPlus“ (Zugriffsdatum: 17.12.2015)
Föderale Staatshaushaltsinstitution „Wissenschaftliches Zentrum für Fachwissen über Medizinprodukte“ des Gesundheitsministeriums der Russischen Föderation. Russische Föderation, 127051, Moskau, Petrovsky Boulevard, 8, Gebäude 2
Kasakow Alexander Sergejewitsch. Leiter der wissenschaftlichen und methodischen Abteilung des Kompetenzzentrums für Arzneimittelsicherheit, Ph.D. Honig. Wissenschaft.
Zatolochina Karina Eduardovna. Leiter der wissenschaftlichen und analytischen Abteilung des Kompetenzzentrums für Arzneimittelsicherheit, Ph.D. Honig. Wissenschaft.
Romanow Boris Konstantinowitsch. Stellvertretender Generaldirektor für Wissenschaft der Föderalen Staatshaushaltsinstitution „NTsESMP“ des Gesundheitsministeriums Russlands, Dr. med. Wissenschaften
Bukatina Tatjana Michailowna. Leitender Forscher der wissenschaftlichen und methodischen Abteilung des Centre for Expertise on the Safety of Medicines, Ph.D. Honig. Wissenschaft.
Velts Natalya Yurievna. Forscher der wissenschaftlichen und methodischen Abteilung des Kompetenzzentrums für Arzneimittelsicherheit, Ph.D. biol. Wissenschaft.
POSTADRESSE
Kasakow Alexander Sergejewitsch, [email protected]
DAS RISIKOMANAGEMENTSYSTEM ALS WICHTIGER TEIL DER GOOD PHARMACOVIGILANCE PRACTICES (GVP)
A. S. Kazakov, K. E. Zatolochina, B. K. Romanov, T. M. Bukatina, N. Yu. Velts
Föderale Staatshaushaltsinstitution „Wissenschaftliches Zentrum für Expertenbewertung von Arzneimitteln“, Gesundheitsministerium der Russischen Föderation, 127051, Russland, Moskau
Zusammenfassung: Das Risikomanagementsystem umfasst den Prozess der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens unerwünschter Wirkungen einer Pharmakotherapie, der Ermittlung des Umfangs und der Größenordnung der Risikoanalyse und der Wahl der Risikomanagementstrategie sowie der Auswahl der hierfür erforderlichen Risikomanagementtechniken und -strategien Möglichkeiten, es zu reduzieren. Somit ist das Risikomanagementsystem ein modernes und effizientes Instrument der Pharmakovigilanz, das darauf abzielt, die Wirksamkeit und Sicherheit der Pharmakotherapie zu verbessern.
Schlüsselwörter: Risikomanagement, Nebenwirkung, Risikomanagementplan, Pharmakovigilanz. Zur Zitierung: Kazakov AS, Zatolochina KE, Romanov BK, Bukatina TM, Velts NY. Das Risikomanagementsystem ist ein wichtiger Bestandteil guter Pharmakovigilanzpraktiken (GVP). Sicherheit und Risiko der Pharmakotherapie 2016; (1): 21-27.
1. Leitlinie zu guten Pharmakovigilanzpraktiken (GVP) – Modul V (Rev 1) EMA/838713/2014. URL: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2012/06/WC500129134.pdf.
2. Leitlinie zu guten Pharmakovigilanz-Praktiken (Good Pharmacovigilance Practice – GVP), zitiert am 11.06.2014. URL: http://www. eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/oo/ Pages/farmakanadzor.aspx (auf Russisch).
3. Zu den Änderungen des Bundesgesetzes „Über den Arzneimittelverkehr“ Nr. 61-FZ und Nr. 429-FZ vom 22.12.2014. Verfügbar ab 12.04.2010. Verfügbar in der Rechtsdatenbank „Consul-Datenbank „Consultant Plus“ (Stand 17.12.2015). tant Plus“ (zitiert am 17.12.2015).
Bundeshaushaltsinstitution „Wissenschaftliches Zentrum für die Expertenbewertung von Medizinprodukten“ des Gesundheitsministeriums der Russischen Föderation. Petrovsky Boulevard 8-2, Moskau, 127051, Russische Föderation
Kazakov AS. Leiter der Abteilung Wissenschaft und Methodik des Kompetenzzentrums für Arzneimittelsicherheit. Doktortitel.
Zatolochina K.E. Leiter der Abteilung für Wissenschaft und Analyse des Kompetenzzentrums für Arzneimittelsicherheit. Doktortitel.
Romanov B.K. Stellvertretender Generaldirektor des Wissenschaftlichen Zentrums für Expertenbewertung medizinischer Anwendungsprodukte. MD, DSc (Med)
Bukatina TM. Leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung für Wissenschaft und Methodik des Kompetenzzentrums für Arzneimittelsicherheit. Doktortitel.
Velts NYu. Forschungswissenschaftler der Abteilung für Wissenschaft und Methodik des Kompetenzzentrums für Arzneimittelsicherheit. Doktortitel.