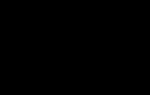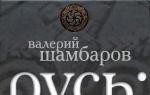Russisch-katholische Kirche des byzantinischen Ritus. Katholische Kirche des byzantinisch-slawischen Ritus in Polen
Die Zuständigkeit des Ordinariats und der entsprechenden Dekanatsstrukturen umfasst Katholiken des byzantinischen Ritus aller Traditionen auf dem Territorium Russlands.
Dekanatsverwaltung für Katholiken des byzantinischen Ritus auf dem Gebiet, das dem Gebiet der römisch-katholischen Erzdiözese Unserer Lieben Frau in Moskau entspricht
Dekan (Protopresbyter):
Erzpriester Evgeniy Yurchenko SDB (- 4. April 2007)
Erzpriester Andrey Udovenko (4. April 2007 -
Pfarrei der Heiligen Apostel Petrus und Andreas (Moskau)
Die Gemeinde wurde 1991 gegründet (die erste griechisch-katholische Gemeinde in Russland). Es stand unter der kanonischen Unterordnung des Leiters der UGCC und wurde dann in die Zuständigkeit des lateinischen Erzbischofs der Erzdiözese der Muttergottes mit Sitz in Moskau überführt. Seit der Gründung des Ordinariats für Katholiken des byzantinischen Ritus in Russland untersteht es der Gerichtsbarkeit seines Ordinariats. In der Gemeindekapelle sind zum Sonntagsgottesdienst 30–40 Personen (Stand 2006), zu Ostern bis zu 80 Personen anwesend. Rektor: Pater Andrey Udovenko [geb. 1961; im März 1991 von der Russisch-Orthodoxen Kirche in die Kommunion aufgenommen] (1991-
Die Ankunft des heiligen Märtyrers. Ignatius der Gottesträger, Bischof von Antiochia (Moskau)
Die Gemeinde wurde auf Erlass des Bischofs gegründet. Joseph Werth vom 7. Februar 2006.
Pfarrer:
Ö. Evgeniy Yurchenko SDB (7. Februar 2006 – 4. April 2007)
Ö. Sergey Nikolenko (4. April 2007-
Pfarrervikare - Fr. Alexander Simchenko (im Jahr 2005), Fr. Kirill Mironov (-4. April 2007). Zuvor betreute die Pfarrei einige Zeit lang Pastoralzentren (Zweiggemeinden), die 2012 nicht mehr existieren: St. Olga (verantwortlicher Priester - Pater Kirill Mironov), St. Lazarus (verantwortlicher Priester - Pater Sergiy Nikolenko), Geburt der Jungfrau Maria (verantwortlicher Priester - Pater Alexander Simchenko). Ungefähr 40 Gemeindemitglieder (Stand Mitte 2006).
Gemeinschaft zu Ehren des Heiligen Clemens, Papst von Rom (Obninsk)
Die Gemeinschaft wurde 2004 von Abt Rostislav gegründet. Durch Dekret von Bischof Joseph Werth vom 26. Februar 2006 als Pfarrei gegründet. Rektor: Abt Rostislav (Kolupaev) [2004 von der Russisch-Orthodoxen Kirche in die Kommunion aufgenommen] (2006 – 4. April 2007)
Ö. Kirill Mironov (4. April 2007 - 2009)
Pater Alexander Samoilov (2009 - September 2010)
Seit Dezember 2010 besucht Pater Valery Shkarubsky die Gemeinschaft einmal im Monat. Die Gemeinschaft verfügt noch immer über kein festes Gebäude, und die Gläubigen versammeln sich in Privatwohnungen und empfangen einen Priester nach dem anderen. Die Zahl der Gemeindemitglieder beträgt etwa 10.
Gemeinschaft im Namen des Hl. Gleichgestellt mit den Aposteln Methodius und Cyril, slowenischen Lehrern (St. Petersburg)
Tatsächlich entstand die erste Gemeinschaft von Laien des östlichen Ritus im Herbst 2001, als eine Gruppe von Gläubigen der rein katholischen Votivgemeinschaft der Laien „Ritter vom Heiligen Kreuz des Herrn“ begann, Gebetstreffen abzuhalten der östliche Ritus etwa alle zwei Wochen. Die Gemeinschaft wurde „im Namen des heiligen Erzengels Michael“ benannt und wurde (wie die Ritter) von Pavel Parfentyev geleitet. Die erste Liturgie für die Gemeinschaft wurde am 31. Januar 2002 vom Priester (P. Sergius Golovanov) gefeiert. Nach einem halben Jahr wurden einzelne Treffen der Ritter des östlichen Ritus eingestellt, nur manchmal wurden auf Wunsch der Gemeinschaft Liturgien von Gastpriestern abgehalten (die regelmäßigsten fanden von Mitte 2004 bis Mitte 2005 statt – etwa einmal alle). 3 Monate). Im August 2005 gründeten Laien, die der Rittergemeinschaft nicht beitreten wollten, die Gemeinschaft „St. Methodius und Kyrill“ und im September begannen die regelmäßigen Liturgien. Im November 2005 löste sich die „Gemeinschaft im Namen des Heiligen Erzengels Michael“ auf und ihre Mitglieder schlossen sich der Gemeinschaft des Heiligen Erzengels Michael an. Methodius und Cyril. Die Gemeinde zählt etwa 25 Personen. Seit Anfang 2013 begann die Gemeinde, Gottesdienste in belarussischer Sprache abzuhalten.
Schulleiter Alexander Smirnov (Frühjahr – November 2006)
Gemeinschaftswächter: Pater Evgeniy Matseo VE (September 2006 – 4. April 2007)
Ö. Kirill Mironov (4. April 2007 - 2014)
Ö. Alexander Burgos (bis 2015 –
Gemeinschaft der Heiligen Euphrosyne von Polozk (Kaliningrad)
Die Community wurde 2010 gegründet. Gottesdienste finden jedes zweite Wochenende in der römisch-katholischen Kirche der Heiligen Familie statt. Pflegend. Pater Kirill Mironov aus St. Petersburg. An den ersten Gottesdiensten nahmen 13-14 Personen teil, davon 10 Weißrussen. Im Jahr 2015 wurde die Gemeinschaft bereits von Hieromonk Andrei Zalewski betreut.
Dekanatsverwaltung für Katholiken des byzantinischen Ritus auf dem Gebiet der Diözese Preobraschensk mit Sitz in Nowosibirsk.
Dekan (Protopresbyter) – Fr. Ivan Lega
Pfarrei der Seligen Märtyrer Olympia und Laurentius (Nowosibirsk)
Im Oktober 2015 wurden nach einer sechsmonatigen Pause die regulären Gottesdienste wieder aufgenommen (in der Kapelle der seligen Märtyrer Olympia und Laurentius in der unteren, „byzantinischen“ Kirche der Kathedrale der Verklärung des Herrn). Die Gemeinde ist etwas größer mehr als ein Dutzend Menschen. Der Rektor ist Pater Ivan Lega.
Pfarrei im Namen von St. Cyril und Methodius (Sargatskoje)
Die Pfarrei wurde per Erlass des Bischofs als Pfarrei des byzantinischen Ritus der slawisch-russischen Tradition gegründet. Joseph Werth als lokaler Hierarch des lateinischen Ritus im Jahr 1997 (fol. Proletarskaya, 14). Der erste nach Sargat geschickte Priester, Pater George (der von der russisch-orthodoxen Kirche konvertierte), wurde von den Kosaken geschlagen, woraufhin er die Gemeinde und die katholische Kirche verließ.
Äbte:
Ö. Georgy Gugnin (1994-1996)
Ö. Sergey Golovanov (1997 – Dezember 2005)
Ö. Andrey (Yuri) Startsev VE (2006-?)
Hieromonk Dmitry Kozak (2015 -
Tempel des seligen Beichtvaters Leonid, Exarch von Russland
Gemeinschaften, die kanonische Anerkennung suchen
Gemeinschaft des Heiligen Archimandriten Clemens (Scheptyzkyj) (Krasnojarsk)
Im April 2009 trennte sich Pater Konstantin Zelenov in Erwartung des Zusammenbruchs des VCU ORC von ihm (einige der Pfarreien und Gemeinden des VCU ORC, darunter auch die zuvor von Pater Konstantin betreuten, traten der Russisch-Orthodoxen Kirche bei, blieben aber nicht dort) wandelte die Gemeinde in eine griechisch-katholische um und begann einseitig mit dem Gedenken an den Papst. Die Gemeinschaft steht in der slawisch-russischen Tradition, existiert mit dem Wissen von Bischof Joseph Werth und strebt die Erlangung des offiziellen kanonischen Status an. Am 13. Oktober 2011 erhielt Pater Konstantin von Bischof Joseph Werth ein Antimension und ein heiliges Chrisam. Im Sommer 2012 bestand die Gemeinde aus 18 Personen. Für einige Gemeindemitglieder wird eine Liturgie nach altem Ritus abgehalten.
Gemeinschaften, die ein klösterliches Leben führen und die kanonische Anerkennung als Mönche anstreben
Diese Gemeinschaften hatten bis Mitte 2006 noch keine offizielle kirchliche Anerkennung als Klostergemeinschaften erhalten und sind somit Gemeinschaften, die privat ein klösterliches Leben führen und eine kirchliche Anerkennung anstreben.
Spaso-Preobrazhenskaya-Gemeinschaft der Mönche des Heiligen Basilius des Großen
Hegumen Philip Maizerov. Hieromonk Pater Alipy Medvedev [1999 von der Russisch-Orthodoxen Kirche in die katholische Kirche aufgenommen]. Nach ihrer Aufnahme im Jahr 1999 studierten die Mönche in Rom. Sie kamen 2004 nach Russland und ließen sich im Dorf Sargatsky nieder, wo im Dezember 2004 ein unterirdisches (nicht registriertes) griechisch-katholisches Kloster gegründet wurde. Beteiligte sich an dem Versuch einer Gruppe von Priestern, die Kirchenstrukturen des Apostolischen Exarchats für russische Katholiken des byzantinischen Ritus in Russland wiederzubeleben, was jedoch erfolglos blieb. Im Februar 2006 wurde das Kloster geschlossen und die Mönche aus dem Gelände vertrieben. Nach der Schließung des Klosters zogen die Patres in die Slowakei und schlossen sich der Diözese Presov an, wo sie mehrere Monate lang dienten. Danach kehrten sie nach Russland zurück (von Oktober 2006 bis Januar 2007 lebten sie in der Ukraine). Sie lebten als Privatpersonen in der Russischen Föderation und dienten in ihrem Heimatland nur privat (für ihre Gemeinde). Pater Alypiy starb am 22. Dezember 2012 an einem Schlaganfall. Hegumen Philip lebt in St. Petersburg und hat einen zivilen Job.
Gemeinschaft der Schwestern im Namen des Hl. Nil Sorsky (Moskau)
Gegründet von Abt Märtyrer Bagin (einem ehemaligen Priester der Russisch-Orthodoxen Kirche, wo ihm am 15. September 1998 der Dienst verboten wurde (er veröffentlichte eine Sprachaufnahme mit Patriarch Alexy II.), trat er 1999 der katholischen Kirche bei; von 2000 bis 2010 Er diente in Deutschland als Beichtvater des Collegium Orientale-Seminars in der bayerischen Stadt Eichstätt, der der Beichtvater der Gemeinschaft ist. Beinhaltet Schwestern, die ein klösterliches Leben führen, und mehrere Novizinnen mit Sitz in Moskau. Die Gemeinschaft unterstützt Laien und Familien im geistlichen Leben und leistet ökumenische Arbeit. Gemeinschaft der Schwestern im Namen des Hl. Nila Sorsky existiert mit dem Wissen von Bischof Joseph Werth und strebt danach, als Klostergemeinschaft den kanonischen Status zu erlangen.
Laiengemeinschaften privater Natur
Die in dieser Liste vertretenen Gemeinden haben keinen offiziellen Status. Ein Teil der vertretenen Gemeinschaften strebt die Aufnahme an, der Rest behält einen privaten Charakter bei, der durch das kanonische Recht der katholischen Kirche zulässig ist.
Gemeinschaften im Namen des Metropoliten St. Philip von Moskau (Moskau)
Die Gemeinschaft wurde 1995 von einer Initiativgruppe griechischer Katholiken gegründet. Die Hauskirche wurde in der Wohnung des älteren Wladimir Belov [gest. 7. März 2004] (Filyovsky Boulevard, Gebäude 17). Fr. serviert darin. Stefan Caprio (Russicum-Absolvent, der als Rektor der römisch-katholischen Gemeinde in Wladimir fungierte). Nach der Vertreibung von Pater Stefan im April 2002 war die Gemeinschaft für einige Zeit ohne Nahrung und verlor einige ihrer Gemeindemitglieder. Die Heimatkirche der Gemeinde wird auf Einladung manchmal von Abt Innokenty (Pavlov) betreut (einem Geistlichen der Russisch-Orthodoxen Kirche, der als Mitarbeiter entlassen wurde und sich nicht offiziell der katholischen Kirche anschloss).
Gemeinschaft des Heiligen Sergius von Radonesch (Serpuchow)
Im Jahr 2003 trat die Edinoverie-Gemeinschaft (Donikon-Ritus) der ROCOR unter der Leitung von Priester Kirill (Mironov) der katholischen Kirche bei. Im Jahr 2005 weigerte sich die Mehrheit der Gemeindemitglieder, sich den etablierten Strukturen der Russischen Staatlichen Katholischen Kirche anzuschließen und ging in verschiedene orthodoxe Gerichtsbarkeiten des alten Ritus, die in der Stadt Serpuchow gegründet wurden, wodurch die Gemeinde aufhörte zu funktionieren, und Kirill (Mironov) begann seinen Dienst in der Pfarrei des Heiligen Märtyrers. Ignatius der Gottesträger.
Gemeinschaft des Hl. Andreas des Erstberufenen (Nischni Nowgorod)
Sie wurde auf Initiative von Nikolai Derzhavin (dem Oberhaupt der Gemeinschaft) gegründet und umfasste mehrere Laiengläubige. Derzeit liegen keine Informationen über die Existenz und Aktivitäten dieser Gemeinschaft vor.
Gemeinschaft des Heiligen Beichtvaters Leonty, Exarch von Russland (Schukowski, Region Moskau)
Es wurde auf Initiative von Alexander Shvedov (Gemeindeältester), einem Gemeindemitglied der Pfarrei im Namen des Heiligen Märtyrers, gegründet. Ignatius von Antiochia. Über die Aktivitäten der Community liegen derzeit keine Informationen vor.
Gemeinschaft im Namen der Geburt der Heiligen Jungfrau Maria (Pavlovsky Posad)
Rektor: Priester Alexander Simchenko. Die Gemeinschaft hörte auf zu existieren.
„Gemeinschaft im Namen des seligen Leonid Fedorov“
Im Jahr 2001 erschien im Internet eine Website einer bestimmten „Gemeinschaft im Namen des seligen Leonid Fedorov“ in St. Petersburg. In Wirklichkeit hat eine solche Gemeinschaft nie existiert; die Website „Gemeinschaft im Namen des seligen Leonidas“ war eine Einzelinitiative einer Person. Den vorliegenden Informationen zufolge ist der Ersteller der Website derzeit Mitglied des Abgeordneten der Russisch-Orthodoxen Kirche.
Betrieb 1908-1937
Pfarrei Mariä Geburt (Moskau)
Im Jahr 1894 schließt sich Priester Nikolai Tolstoi Rom an und richtet nach seiner Rückkehr nach Moskau in seinem Haus eine Kapelle ein, in der sich Katholiken heimlich versammeln. Bald erfuhr die Synode davon und Pater Nikolaus wurde seines Amtes enthoben und ihm wurde die Abhaltung von Gottesdiensten untersagt. Tatsächlich wurde die Pfarrei Mariä Geburt im Jahr 1918 von Exarch Leonid Fedorov gegründet. Im Jahr 1922 waren nur noch etwa 100 Gläubige übrig.
Äbte:
Ö. Nikolai Tolstoi (1894 - ?)
Ö. Vladimir Abrikosov (29. Mai 1917 - 17. August 1922) (am 17. August 1922 verhaftet; am 29. September 1922 aus der UdSSR ausgewiesen, lebte und war bis 1926 in Rom tätig, danach ging er in den Ruhestand und lebte in Paris, starb am 22. Juli 1966)
Ö. Nikolai Alexandrow (17. August 1922 (ordiniert im Januar 1922) – 13. November 1923)
Pfarrei der Herabkunft des Heiligen Geistes (Petrograd)
Im Oktober 1905 kommt Fr. nach St. Petersburg. Alexei Zerchaninov (konvertierte 1896 zum Katholizismus, wurde danach inhaftiert und dann ins Exil geschickt) und beginnt in seinem Zimmer die Liturgie zu feiern. Im Jahr 1909 kommt Fr. an. Evstafiy Susalev (Altgläubiger Priester von Belokrinitsky Consent, der ein Jahr zuvor zum Katholizismus konvertierte). In dem Haus, in dem Pater lebte. Zerchanov (Polozova Str., 12) wird eine Heimatkirche, der Tempel des Heiligen Geistes, errichtet (geweiht am 28. März 1909, geschlossen 1914). Pater Eustathius leitet eine Gruppe von „Altgläubigen, die die Gemeinschaft mit Rom annehmen“. Am 15. April 1911 wurde die Kapelle in eine Pfarrkirche umgewandelt. Aufgrund der Zunahme der Herdenzahl wurde ein neues Gebäude gefunden, das am 30. September 1912 geweiht wurde. 1914, nach der Versiegelung der Heilig-Geist-Kirche, bildeten sich kleine Gruppen um die Priester – Pater Alexei, der in der lateinischen Kirche St. Katharina diente (30 Personen kamen zu den Gottesdiensten – 40 Personen), Pater John Deibner (versammelt in der versiegelten Kirche des Heiligen Geistes auf Barmaleeva) und Pater Gleb Verkhovsky, der 1915 kam (gedient). in einer Wohnung und dann in der Kirche St. Johannes der Täufer in der Sadovaya-Straße) überstieg die Gesamtzahl nicht 300 Menschen. Die Pfarrei der Herabkunft des Heiligen Geistes wurde offiziell mit der Gründung des Exarchats am 2. April 1917 auf der Bolschaja Puschkarskaja gegründet. Im Jahr 1918 gab es etwa 400 Gläubige. Am 14. September 1921 wurde der Grundstein für die Klostergemeinschaft des Heiligen Geistes gelegt (Schwestern Justinia Danzas und Eupraxia Bashmakova). Am 5. Dezember 1922 wurden alle katholischen Kirchen der Stadt versiegelt. Im Jahr 1922 waren nur noch etwa 70 Gläubige übrig. Im Jahr 1923 wurde der neu ordinierte und ernannte Pfarrer der Gemeinde, Pater Dr. Epiphanius wird verhaftet. Nach der Befreiung diente er zwei Jahre lang (1933-37) in verschiedenen Kirchen in Leningrad.
Äbte
Ö. Alexey Zerchaninov (1905-1914)
Ö. Leonid Fjodorow (1917-1922)
Ö. Epifaniy Akulov (August 1922–1923 und 1933–1937) (hingerichtet am 25. August 1937)
Serviert: Fr. John Deubner (1909 – 17. November 1923)
Ö. Alexey Zerchaninov (1914 – Juni 1924)
Ö. Evstafiy Susalev (1909 - Juni 1918)
Ö. Gleb Werchowski (1915 – Juli 1918)
Ö. Diodorus Kolpinsky (vom lateinischen Ritus konvertiert) (1916 - 1918)
Ö. Trofim Semyatsky (1917 - ?)
Diakon Nikolai Targe (-1918)
Ö. Nikolai Mikhalev (1927–1929 und Juli 1934–Mai 1935)
Pfarrei der Kasaner Gottesmutter (Siedlung Nischnjaja Bogdanowka, Gebiet Lugansk, Ukraine)
Am 29. Juni 1918 trat der Pfarrer der Pfarrei Edinoverie, Hieromonk Potapiy (Emelyanov), zusammen mit seiner Pfarrei der katholischen Kirche bei. Zuvor wurde er von der örtlichen Versammlung zweimal zum Rektor der Kirche gewählt, obwohl ihm zuvor (8. Februar 1918) der Dienst in der vorherigen Pfarrei verboten wurde. Aufgrund der Weigerung des Rektors der Kirche, ihn zu bestätigen, erfolgte ein Übergang zur katholischen Kirche. Der alte Ritus wurde im Gottesdienst verwendet. Die Gemeinde zählte in der ersten Periode ihres Bestehens (1918-1919) etwa 1.000 Menschen. Im Oktober-Dezember 1918 und September-Dezember 1919 wurde er inhaftiert (er wurde von den roten Einheiten freigelassen). Nach seiner Rückkehr nach Nischnjaja Bogdanowka konnte er die Kirche trotz der Entscheidung des Liquidationsausschusses nicht zurückgeben (im Mai 1922 wurde die Kirche offiziell der griechisch-katholischen Gemeinde übergeben, blieb aber bis zuletzt in den Händen der Orthodoxen). ). Pater Potapiy diente in einem kleinen Privathaus. Im Jahr 1924 zählte die Gemeinde 12 Personen. Am 27. Januar 1927 wurde Pater Potapiy verhaftet und nach Solovki verbannt (starb 1936), und die Gemeinschaft hörte praktisch auf zu existieren.
Odessa
In den 1920er Jahren diente Pater in Odessa. Nikolai Tolstoi (-1926)
1917 gab es in Wologda, Petrosawodsk, Archangelsk und Jaroslawl Gemeinden ohne Priester. Im Jahr 1922 gab es in Saratow nur noch eine Gemeinschaft von 15 Menschen und einzelne Gläubige (etwa 200 Menschen) in anderen Siedlungen (viele Gläubige waren zu diesem Zeitpunkt geschlagen oder ausgewandert, etwa 2.000 Menschen verließen die katholische Staatskirche Russlands).
Ausländische Gemeinden
Kirchengemeinde (Berlin)
Sie wurde 1927 aus russischen weißen Emigranten gegründet, als der neu geweihte Priester Pater Dimitri nach Berlin geschickt wurde. Zunächst dienten sie in der Kapelle des Karmeliterklosters. In den Jahren 1926–34 wurden die Gottesdienste auf dem lateinischen Altar in der Thomaskapelle abgehalten, anschließend wurden die Gottesdienste in eine kleine Hauskapelle in der Schlüterstraße 72 verlegt (wo sogar der Einbau einer Ikonostase unmöglich war). Im Jahr 1932 Fr. Demetrius (als Beichtvater der Studiten nach Löwen versetzt) wurde durch Pater Dr. Wladimir (1930 zum Priester geweiht). Die Veröffentlichung des Gemeindeblattes begann. Es gab eine Laien-Bruderschaft, benannt nach dem Heiligen Wundertäter Nikolaus. Insgesamt gab es Mitte der 30er Jahre etwas mehr als 110 Gemeindemitglieder und weitere 20 Personen in der Provinz. Die Gemeinde lebte nach dem gregorianischen Kalender. 1943 traf eine Bombe das Haus mit der Kapelle und Pater Wladimir wurde von der Gestapo verhaftet (nach dem Krieg wieder freigelassen). Nach dem Krieg wurde die Gemeinde sehr klein und nach dem Tod von Pater Wladimir hörte sie auf zu existieren.
Äbte: Fr. Dimitri Kusmin-Karawajew (1927-1931)
Ö. Vladimir Dlussky (1932–1943 und 1945–1967)
Kirchengemeinde (München)
Im Jahr 1946 wurde eine kleine, aber aktive Gemeinde gegründet und eine Hauskirche gegründet. Nach einiger Zeit hörte die Gemeinschaft jedoch auf zu existieren und auf ihrer Grundlage existiert nur noch eine pastorale Funktion.
Rektoren: Pater Methodius (1946-1949)
Pater Karl Ott (1949-2002)
Ö. Yuri Avvakumov (200*-
Pfarrei Mariä Verkündigung (Brüssel)
1951 gründete Bischof Pavel, der in die Stadt zog, eine Gemeinschaft und begann in der Hauskirche zu dienen. Im Jahr 1954 wurde das Haus, in dem die Verkündigungskirche gebaut wurde (Avenue de la Couronne. 206), gemietet. Pater Anthony wurde zum Rektor ernannt (Bischof Paul bleibt Treuhänder). Bei Gottesdiensten sind 10-15 Personen anwesend.
Rektor: Bischof Pavel Meletyev (1951-1954)
Ö. Antony Ilts (1954-
Diakon Wassili von Burman diente (1955-1960)
Pfarrei der Heiligen Dreifaltigkeit (Paris)
Die erste Liturgie wurde 1925 von Hieromonk Alexander Evreinov gefeiert. Im Jahr 1927 wurde eine Pfarrei gegründet und ein Gebäude in der Avenue Ser Rosalie gekauft (die Kirche wurde 1928 geweiht). 1934 wurde ein neues Gebäude erworben (Rue François Girard 39). Im Jahr 1936 wurde das Service auf einen neuen Stil umgestellt. Bis 1954 war es der russischen Pfarrei zugeordnet, dann wurde es selbstständig. Eine ziemlich große und stabile Gemeinde.
Äbte:
Ö. Alexander Jewreinow (1927-1936)
Abt Christopher Dumont (1936–1954)
Ö. Pavel Grechishkin (30. Januar 1954–1964)
Ö. Alexander Kulik (1964-1966)
Ö. Georgiy Roshko (1966 - 1997)
Ö. Peter (Bernard) Dupier (5. April 2000 – (1997–2000, verantwortlich für Angelegenheiten)
Serviert
Ö. Michail Nedtochin (1936-194*)
Ö. Pawel Gretschischkin (1947-1954)
Ö. Georgy Roshko (1957-1966)
Ö. Henri Pigean (1966–18. Oktober 1974)
Ö. Joel Courtois (2001-
Pfarrei (Nizza)
Im Jahr 1928 wurde eine kleine Hauskirche byzantinischen Ritus errichtet (20 Avenue de Pessicard). Rektor Fr. Alexander Deibner (1928-1930) (1930 zur Orthodoxie konvertiert). Die Gemeinschaft hörte auf zu existieren und die Gläubigen blieben ohne Nahrung zurück.
Pfarrei St. Irenäus von Lyon (Lyon)
Im Jahr 1930 begann die Gemeinschaft von Pater Dr. Ein Löwe. Am 18. Dezember 1932 wurde die Hauskirche in der Rue Auguste Comte geweiht.
Äbte
Ö. Lew Schedenow (1930-1937)
Ö. Nikolai Bratko (1937 - 3. April 1958)
Pfarrei St. Antonius (Rom)
Seit 1910 war die St.-Laurentius-Kirche (in der Nähe des Trojanischen Forums) in Betrieb, die 1932 geschlossen und zerstört wurde (wegen Arbeiten am Wiederaufbau der Stadt). Am 20. Oktober 1932 wurde eine neue Kirche geweiht – St. Antonius im Stift Russicum.
Äbte:
Pater Sergei Verigin (1910-1938)
Pfarrei (Wien)
Die Gemeinde erhielt einen Platz in der Kapelle der Erzengel-Michael-Kathedrale, die komplett erneuert und mit einer Ikonostase ausgestattet wurde. Die Gemeinde zählte bis zu 100 Personen. Nach dem Krieg hörte es auf zu existieren.
Rektor Fr. Pawel Gretschischkin (1931-1947)
Pfarrei St. Ap. Andreas der Erstberufene (San Francisco)
Die Organisation der Gemeinschaft begann durch Pater Dr. Michael, vom lateinischen Erzbischof eingeladen, unter den Molokanen zu arbeiten. Die Kirche wurde am 27. September 1937 geweiht. 1939 kam ein neuer Abt, ein Engländer, der erfolglos versuchte, die Bekehrung der Molokaner fortzusetzen. Später wechselte er zum Ukrainischen Basilianerorden. 1955 mussten wir uns von den alten Räumlichkeiten trennen. In der Friedhofskapelle fanden vorübergehende Gottesdienste statt. Am 12. Dezember 1957 gründeten die Gemeindemitglieder eine neue Kirche – die ehemalige lateinische Kirche St. Antonius in El Segundo. In den 1970er Jahren wurde die Mehrheit der Gemeindemitglieder englischsprachig und die Gottesdienste wurden auf Englisch umgestellt. Am 17. Juni 1979 wurde das Gemeindemitglied Gabriel Seamore zum ständigen Diakon geweiht (und fungierte im ersten Halbjahr 1985 und von 1986 bis 1987, als es keinen ständigen Priester gab, als eigentlicher Pfarrer der Gemeinde). Im Jahr 2019 zählte die Gemeinde etwa 40 Personen.
Äbte:
Ö. Michail Nedotochin (1935-1939)
Ö. John Ryder (1939–1954)
Ö. Fionan Brannigan (1954 – Juni 1972)
Ö. Theodore Wilcock (1972 – 25. Januar 1985)
Ö. Lavrenty Dominic (Juli 1985 – Juli 1986)
Ö. Alexiy Smith (28. Juni 1987 -
Pfarrei St. Mikhail (New York)
Fr., der 1935 in New York ankam, begann mit der Gründung der Gemeinschaft. Andrej. Im Jahr 1936 wurde in der Pfarrschule der alten St. Patrick's Cathedral auf dem Friedhof in New York eine Kapelle eingerichtet (Gottesdienste fanden täglich statt). Nach dem Tod des ersten Rektors wurde die Gemeinde zehn Jahre lang von Jesuiten aus der Gemeinschaft der Fordham University betreut. Eine der größten und stabilsten Gemeinschaften des russischen byzantinischen Ritus.
Äbte:
Ö. Andrey Rogosh (1936 - 17. Oktober 1969)
Ö. Joseph Lombardi (1979-1988)
Ö. John Soles (1988-)
Pfarrei Unserer Lieben Frau von Fatima (San Francisco)
Die Gemeinschaft wurde von Pater gegründet, der 1948 aus Harbin kam. Nikolaus, 1950 begann Pater Nikolaus mit dem Gottesdienst in der St.-Ignatius-Kirche. 1954 wurde eine unabhängige Gemeinde gegründet und eine Kirchenkapelle gebaut (101 20th Avenue). Mittlerweile ist die Gemeinde multinational, der Gottesdienst wird nach dem Synodalritus abgehalten, die Gesänge werden auf Englisch gesungen. Bis 2005 wurde die Gemeinschaft ausschließlich von Jesuitenpriestern betreut. Im Jahr 2012 zog die Gemeinde an einen neuen Standort.
Äbte:
Ö. Nicholas Bock (1948-1954)
Ö. Andrei Urusov (Andrei Russo) (1954 – Juli 1966)
Ö. Karl Patel (9. März 1967 -) (zweiter Priester 1958–1967)
Ö. John Geary
Ö. Steven A. Armstrong (1993–1999)
Ö. Mark Ciccone (- 9. Oktober 2005)
Ö. Eugene Ludwig (9. Oktober 2005 -
Ö. Vito Perrone (- 2013)
Ö. Kevin Kennedy (2013 -
Serviert:
Theodor Frans Bossuyt (Januar 1969 -)
Diakon Kirill (Bruce) Pagach (August 2005 -
Gemeinschaft St. Cyril und Methodius (Denver)
1999 entstand in Denver eine Initiativgruppe, die eine Gemeinschaft russischer Katholiken des byzantinischen Ritus gründete. Im Jahr 2003 ernannte die römisch-katholische Pfarrei St. Katharina von Ungarn in Denver einen verheirateten Priester des Östlichen Ritus, Pater Chrysostomus Frank (der Priester in der OCA war und sich 1996 der katholischen Kirche anschloss), der die Gemeinde St. Cyril gründete Methodius wurde Rektor und begann wöchentlich die Liturgie zu halten. Ursprünglich wurde der Gemeinschaft des Östlichen Ritus ein separater Bereich zugewiesen, doch bis 2006 wurde das gesamte Innere der Kirche renoviert, um den Bedürfnissen beider Gemeinschaften gerecht zu werden. Die Messe nach dem lateinischen Ritus wird um 9 Uhr morgens gefeiert, die Liturgie des Hl. Johannes Chrysostomus (in englischer Sprache) um 12 Uhr. Im Juni 2016 wurde die russisch-katholische Gemeinde von der Kirche St. Katharina in die Kapelle St. John Francis Regis verlegt (Jean-Francois Regis), die sich an der privaten Jesuiten-Regis-Universität befindet (Vater Chrysostomus war weiterhin Pfarrer).
Pfarrei der Darstellung der Heiligen Jungfrau Maria im Tempel (Montreal)
1951 wurde Pater nach Kanada berufen. Römischer Caccutti. 1956 begann die Gemeinde mit dem Bau einer Kirche, die 1959 geweiht wurde. Die Gemeinde war klein und nach dem Tod des Pfarrers bestand sie nicht lange und hörte 1997 auf zu existieren.
Äbte
Ö. Joseph Leddy (gestorben 1956 – 2. Februar 1986)
Ö. Leoni Pietro (1986-1995)
Pfarrei St. App. Peter und Paul (Buenos Aires)
Die Gemeinschaft wurde von Philip organisiert. In einem gewöhnlichen Haus wurde eine Kirche gebaut (Guemes 2962). Ende der 40er Jahre zählte die Gemeinde 250 Menschen, 1953 wuchs sie auf 300. Später wurde eine weitere Kirche gebaut – Verklärung. Die Pfarrei unterliegt der Gerichtsbarkeit des Ordinariats für die treuen orientalischen Riten in Argentinien.
Äbte:
Ö. Philippe de Regis (1946–19. Februar 1954)
Archimandrit Nikolai Alekseev (-23. April 1952)
Serviert:
Ö. Valentin Tanaev (1947-195*)
Ö. Alexander Kulik (1948-1966)
Ö. Georgy Kovalenko (12. Januar 1951–1958)
Ö. Pavel Krainik (1957-?)
Ö. Domingo Crpan
Pfarrei Mariä Verkündigung (São Paulo)
Die Gemeinschaft wurde von Pater organisiert. Basilikum. 1954 erhielten brasilianische katholische Nonnen in Ipiranga ein Gebäude, in dem eine Kirche errichtet wurde. Im August 2013 wurde die Gemeinde der Russisch-Orthodoxen Kirche unterstellt.
Äbte:
Ö. Wassili Bourgeois (1951 – 8. April 1963)
Ö. Fedor Wilcock (1963-1966)
Ö. John Stoisser (1966-2004)
Serviert:
o John Steusser (1955-1966)
Ö. Fjodor Wilcock (1957-1963)
Ö. Vikenty Pupinis (196*-1979)
Ö. Wassili Ruffing (1981-?)
Gemeinschaft (Santiago)
Rektor Fr. Wsewolod Roshko (1949-1953)
Gemeinschaft von St. Nicholas (Melbourne)
Im Jahr 1960 kam Fr. an. Georgy Bryanchaninov, der die Gemeinschaft organisierte, finden Gottesdienste in der St.-Nikolaus-Kirche statt. Pater George ist immer noch Pfarrer der Gemeinde. Im Jahr 2008 zog die Gemeinde nach Victoria. Der zweite Priester war der Dominikanerpater Peter Knowles von den 1960er Jahren bis zu seinem Tod am 11. März 2008. Am 25. Dezember 2006 ging Pater Georgy Brianchaninov in den Ruhestand und lebt in einem Pflegeheim. Die gesamte Betreuung der Pfarrei lag auf den Schultern von Priester Lawrence Cross (der am 25. Juni 2001 zum Priester geweiht wurde). Ein Jahr später musste die Gemeinde den alten Ort in Melbourne verlassen; von Februar bis Juli 2008 fanden Gottesdienste in der Kapelle der Universität Melnur statt. Im August 2008 zog die Gemeinde in neue Räumlichkeiten in der Stadt North Fitzroy um.
Gemeinschaft (Sydney)
1949 kamen die meisten Gläubigen aus Harbin in Australien an. 1951 kam Pater Andrew aus London und Gottesdienste wurden in der Kathedrale St. Patrick.
Äbte
Ö. Andrey Katkov (1951-1958)
Ö. Georgy Bryanchaninov (1957-1960)
Ö. Georgy Arts (1963-
Spirituelle Mission zur Unterstützung der Russen in Litauen (Kaunas)
Im Jahr 1934 kehrte der Bischof des Östlichen Ritus, Petras Buchis, nach Litauen zurück und kümmerte sich um russische Gemeinden im Ausland. Trotz seiner eigenen Zurückhaltung und mangelnder staatlicher Unterstützung begann Bischof Buchis auf Druck des Vatikans, im östlichen Ritus zu dienen – seine erste Liturgie in Litauen feierte er am 21. Oktober 1934 in einer Jesuitenkirche. An der Veranstaltung nahmen zahlreiche russische Intellektuelle teil. Im Dezember erhielt man die Erlaubnis, in der ehemaligen orthodoxen Peter-und-Paul-Kathedrale (1919 in die Garnisonskirche des Erzengels Michael umgewandelt) zu dienen. Das Interesse an der neuen Initiative ließ jedoch schnell nach, und bereits im März 1935 stellte Bischof Buchis einen Antrag auf Überstellung nach Amerika, wiederum ohne Erfolg. Im Herbst 1935 zog Bischof Buchis nach Telšai, die regulären Gottesdienste in Kaunas wurden eingestellt, aber der Bischof besuchte russische Dörfer (orthodoxe und altgläubige), wo er diente und zu predigen versuchte. Anfang 1937 gründete die Kongregation der Ostkirchen die Geistliche Mission zur Hilfe für die Russen Litauens, deren Leiter Bischof Buchis wurde, der im Sommer 1937 nach Kaunas zurückkehrte und die wöchentlichen Gottesdienste in der Kathedrale von Kaunas wieder aufnahm. Im Herbst 1937 wurden der niederländische Priester Joseph Francis Helwegen und der Diakon Roman Kiprianovich aus Russkikum geschickt, um aus Russkikum zu helfen (im Sommer 1938, weil Bischof Buchis mit seiner Arbeit unzufrieden war, der den Diakon verdächtigte, die Orthodoxen vom Beitritt abzubringen (Die Gewerkschaft und sogar er selbst planten, zur Orthodoxie zu konvertieren, wurde nach Italien verbannt.) Nach seiner Ankunft wurden die Gottesdienste täglich. Im Januar 1938 akzeptierte Semyon Bryzgalov, ein ehemaliger Psalmenleser der orthodoxen Gemeinde Uzpaliai, die Verbindung mit seiner Familie und schloss sich der Mission an. Im Sommer 1938 kam ein neuer Mitarbeiter in Kaunas an, der Ukrainer Ivan Khomenko, der im Dezember 1938 von Buchis zum Diakon geweiht wurde (1940 nach Rom zurückgekehrt). Ebenfalls im Dezember kehrte der marianische Hieromonk Vladimir Majonas, der zuvor in der Harbin-Mission gearbeitet hatte, von Tokio nach Kaunas zurück. An der Sonntagsliturgie nahmen 200-300 Menschen teil, wochentags bis zu 30, aber etwa ein Drittel der Anwesenden waren einfach neugierig, und die Mehrheit waren Katholiken des lateinischen Ritus, die zu spät zur Messe kamen; es gab nur wenige orthodoxe Christen, Viele der angeblichen Konvertierungswilligen verfolgten egoistische Ziele. Im Juli 1939 gelang es Bischof Buchis, dem gewählten General der Mariengemeinde, schließlich nach Amerika auszureisen (und 1951 wurde ihm nach vielen Bitten gestattet, den orientalischen Ritus aufzugeben). Der Russikum-Diplompriester Michail Nedtochin, der im August 1939 in Litauen ankam, wurde zum neuen Leiter der Mission ernannt. Im Juni 1940, nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen, versuchte Pater Michail, das Gebiet Litauens zu verlassen, wurde jedoch verhaftet. Zu Beginn der deutschen Besatzung 1941 wurde er aus der Haft entlassen und nach Italien deportiert. Nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen wurde Priester Helwegen verhaftet und nach Moskau gebracht, aber bald darauf wurde er als ausländischer Staatsbürger freigelassen und kehrte nach Kaunas zurück. Im Mai 1941 wurde Priester Majonas verhaftet und starb später in der Haft. Im Januar 1942 (anderen Quellen zufolge 1943) kehrte auch Priester Helwegen in die Niederlande zurück, nachdem er seinen letzten Geistlichen verloren hatte und ohne eine einzige Pfarrei oder starke Gemeinschaft zu gründen, hörte die Mission auf zu existieren.
Gemeinschaft (Estland)
Die griechisch-katholische russische Gemeinde wurde von Pater Vasily Bourgeois (1932-1945), Pater Dr. John Ryder, SJ (1933-1939) und Fr. Kutner
Im Osten des Römischen Reiches begann sich das Christentum bereits im 1. Jahrhundert auszubreiten. Zu Beginn des 4. Jahrhunderts hörte unter Konstantin dem Großen die Verfolgung der christlichen Kirche auf und das Christentum wurde zur offiziellen Religion des römischen Staates. Im Westen des Römischen Reiches wurde überwiegend Latein gesprochen, während im Osten Griechisch vorherrschte (die Unterschichten Ägyptens und Syriens sprachen Koptisch bzw. Syrisch). Diese Sprachen wurden von Anfang an für die Verkündigung des Christentums und für den Gottesdienst verwendet: Die christliche Bibel wurde schon sehr früh aus dem Griechischen ins Lateinische, Koptische und Syrische übersetzt.
Die frühchristliche Kirche war als System getrennter und unabhängiger Gemeinschaften (Kirchen) mit Zentren in Landes- und Provinzhauptstädten sowie Großstädten organisiert. Bischöfe großer Städte überwachten die Kirchen in den angrenzenden Gebieten dieser Städte. Bereits im 5. Jahrhundert. Es entwickelte sich ein System, nach dem die Bischöfe von Rom, Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem, die üblicherweise Päpste genannt wurden, als Oberhäupter der Kirchen ihrer jeweiligen Region betrachtet wurden, während dem Kaiser die Verantwortung für den Schutz der Kirchen übertragen wurde Kirche und Gewährleistung ihrer Einheit in der Lehre.
Das fünfte Jahrhundert war vom Beginn heftiger christologischer Debatten geprägt, die tiefgreifende Auswirkungen auf die Kirche hatten. Die Nestorianer lehrten, dass in Christus zwei Persönlichkeiten vereint seien – eine göttliche und eine menschliche. Ihre unversöhnlichen Gegner, die Monophysiten, lehrten, dass Christus nur eine Persönlichkeit habe und dass in ihm die göttliche und die menschliche Natur untrennbar zu einer einzigen göttlich-menschlichen Natur verschmolzen seien. Beide Extreme wurden von der etablierten Kirche als ketzerisch verurteilt, doch viele Menschen in Ägypten und Syrien nahmen diese Lehren begeistert an. Die koptische Bevölkerung und ein erheblicher Teil der Syrer bevorzugten den Monophysitismus, während der andere Teil der Syrer sich dem Nestorianismus anschloss.
Am Ende des 5. Jahrhunderts. Das Weströmische Reich brach zusammen und auf seinem Territorium bildeten sich eine Reihe barbarischer Königreiche, doch im Osten existierte das Byzantinische Reich mit seiner Hauptstadt Konstantinopel weiter. Die byzantinischen Kaiser verfolgten wiederholt die Monophysiten und Nestorianer Ägyptens und Syriens. Und als im 7. Jahrhundert. Muslimische Eroberer fielen in diese Länder ein und ein bedeutender Teil der Bevölkerung begrüßte sie als Befreier. Unterdessen vertiefte sich die Kluft zwischen der religiösen Kultur lateinischer und griechischer Christen. So begann der westliche Klerus, die Kirche als eine vom Staat völlig unabhängige gesellschaftliche Institution zu betrachten, wodurch die Päpste im Laufe der Zeit eine Reihe von Befugnissen der früheren kaiserlichen Behörden übernahmen, während im Osten – trotz der Aufgrund der Tatsache, dass die Patriarchen von Konstantinopel den Titel „ökumenische Patriarchen“ trugen, nahm die Bedeutung der Rolle des byzantinischen Kaisers als sichtbares Oberhaupt der Kirche stetig zu. Konstantin der Große, der erste christliche Kaiser, wurde „den Aposteln gleichgestellt“ genannt. Die Spaltung zwischen der westlichen (katholischen) und der östlichen (orthodoxen) Kirche wird normalerweise auf das Jahr 1054 datiert, aber in Wirklichkeit kam es zu einem allmählichen und langfristigen Spaltungsprozess, der eher auf Unterschiede in Bräuchen und Meinungen als auf Unterschiede in der Lehre zurückzuführen war. Als wirklich wichtiges Ereignis, das eine unüberwindliche Entfremdung hervorrief, kann die Einnahme Konstantinopels durch die Kreuzfahrer (1204) angesehen werden, wodurch die griechischen Christen für viele Jahrhunderte das Vertrauen in den Westen verloren.
ORTHODOXE KIRCHE
Das Wort „Orthodoxie“ (griechisch: orthodoxia) bedeutet „richtiger Glaube“. Die Kirche gründet ihren Glauben auf die Heilige Schrift, auf die Lehren der alten Kirchenväter – Basilius des Großen (gest. um 379), Gregor von Nazianz (gest. um 390), Johannes Chrysostomus (gest. 407) und andere wie auf kirchliche Tradition, die hauptsächlich in der liturgischen Tradition bewahrt wird. Strenge dogmatische Formulierungen dieser Lehre wurden von ökumenischen Konzilen entwickelt, von denen die orthodoxe Kirche die ersten sieben anerkennt. Das Erste Konzil von Nicäa (325) verurteilte den Arianismus und verkündete die Göttlichkeit Jesu Christi. Das Erste Konzil von Konstantinopel (381) erkannte die Göttlichkeit des Heiligen Geistes an und vervollständigte damit die Dreifaltigkeit der Heiligen Dreifaltigkeit. Das Konzil von Ephesus (431) verurteilte die Nestorianer und erkannte die hypostatische Einheit Christi an. Das Konzil von Chalkedon (451) erkannte im Gegensatz zu den Monophysiten die Unterscheidung zweier Naturen in Christus an – göttlich und menschlich. Das Zweite Konzil von Konstantinopel (553) bestätigte die Verurteilung des Nestorianismus. Das Dritte Konzil von Konstantinopel (680–681) akzeptierte die Lehre von zwei Willen, dem göttlichen und dem menschlichen, in Christus und verurteilte die Lehre der Monotheliten, die – mit Unterstützung der kaiserlichen Behörden – versuchten, einen Kompromiss zwischen Orthodoxie und Monophysitismus zu finden . Schließlich erkannte das Zweite Konzil von Nicäa (787) die Kanonizität der Ikonenverehrung an und verurteilte die Bilderstürmer, die die Unterstützung der byzantinischen Kaiser genossen. Es wird der maßgeblichste Teil der orthodoxen Lehre betrachtet Eine genaue Aussage des orthodoxen Glaubens Johannes von Damaskus (gest. um 754).
Der bedeutendste Lehrunterschied zwischen der orthodoxen Kirche und den lateinischen Katholiken war die Meinungsverschiedenheit über das Problem der sogenannten. filioque. Das alte Glaubensbekenntnis, das auf dem Ersten Konzil von Nicäa angenommen und auf dem Ersten Konzil von Konstantinopel geändert wurde, besagt, dass der Heilige Geist von Gott dem Vater ausgeht. Doch zuerst in Spanien, dann in Gallien und später in Italien begann man, dem entsprechenden Vers im lateinischen Glaubensbekenntnis das Wort filioque hinzuzufügen, das „und vom Sohn“ bedeutet. Westliche Theologen betrachteten diesen Zusatz nicht als Neuerung, sondern als antiarianische Klarstellung, orthodoxe Theologen waren damit jedoch nicht einverstanden. Einige von ihnen glaubten, dass der Heilige Geist vom Vater durch den Sohn ausgeht, aber obwohl diese Aussage im gleichen Sinne wie die katholische Hinzufügung des Filioque interpretiert werden könnte, hielten es ausnahmslos alle orthodoxen Theologen für inakzeptabel, sie in das Filioque aufzunehmen Glaubensbekenntnis ein Wort, das vom Ökumenischen Rat nicht genehmigt wurde. Photius (gest. 826) und Michael Cerularius, zwei Patriarchen von Konstantinopel, die eine wichtige Rolle in den griechisch-lateinischen Kirchenstreitigkeiten spielten, bezeichneten den Filioque als den tiefsten Irrtum des Westens.
Obwohl sich die orthodoxe Kirche in Fragen der dogmatischen Reinheit, insbesondere im Zusammenhang mit der göttlichen Dreifaltigkeit und der Menschwerdung Christi, durch einen äußersten Konservatismus auszeichnete, blieb das Betätigungsfeld für die Arbeit des theologischen Denkens dennoch sehr weit. Maximus der Bekenner (gest. 662), Theodor der Studiter (gest. 826), Simeon der neue Theologe (gest. 1033) und Gregory Palamas (gest. 1359) leisteten enorme Beiträge zur Entwicklung der christlichen Theologie, insbesondere auf diesem Gebiet der klösterlichen Spiritualität.
Das Mönchtum spielte im Leben der orthodoxen Kirche eine äußerst wichtige Rolle. Mönchtum kann als Rückzug aus der Welt um eines Gebetslebens willen definiert werden, entweder in einer Einsiedelei oder in Gemeinschaft mit anderen Mönchen. Mönche heiraten nicht, besitzen kein persönliches Eigentum und erlegen in den meisten Fällen strenge Einschränkungen beim Essen und Schlafen auf. Die ersten christlichen Mönche erschienen an der Wende vom 3. zum 4. Jahrhundert in der ägyptischen Wüste. Der Wunsch, der Verfolgung und möglicherweise der Nachahmung nichtchristlicher (insbesondere buddhistischer) Vorbilder zu entgehen, mag bei der Entstehung der Mönchsbewegung eine gewisse Rolle gespielt haben, doch der Kern des christlichen Mönchtums war von Anfang an der Wunsch nach Einheit mit Gott durch den Verzicht auf alle anderen Objekte der Begierde. Basilius der Große im 4. Jahrhundert. erstellte eine Klosterurkunde, die – mit geringfügigen Änderungen – noch immer das Leben des orthodoxen Mönchtums regelt. Die Klosterbewegung eroberte sehr schnell Syrien, Kleinasien und Griechenland. Das Ansehen des Mönchtums wurde besonders während der bilderstürmerischen Auseinandersetzungen des 8. und 9. Jahrhunderts gestärkt, als Mönche den Versuchen der byzantinischen Kaiser, Ikonen und heilige Bilder aus Kirchen zu entfernen, entschieden Widerstand leisteten und viele Mönche verfolgt wurden und für den orthodoxen Glauben den Märtyrertod erlitten. Im Mittelalter waren der Olymp in Bithynien und Konstantinopel die wichtigsten Klosterzentren, aber das Hauptzentrum des orthodoxen Mönchtums war und ist bis heute Athos in Nordgriechenland – eine bergige Halbinsel, auf der seit dem 10. Jahrhundert. Es entstanden Dutzende Klöster.
Der erste große Theoretiker der klösterlichen Spiritualität war Evagrius von Pontus (gest. 399), der glaubte, dass die menschliche Seele durch den Sündenfall mit dem Fleisch vereint sei und dass das Fleisch die Ursache für die Leidenschaften sei, die den Menschen ablenken von Gott. Daher betrachtete er das Hauptziel des klösterlichen Lebens darin, einen Zustand der Leidenschaftslosigkeit (Apatheia) zu erreichen, durch den die Erkenntnis Gottes erreicht wird. Das Zweite Konzil von Konstantinopel verurteilte die origenistische Lehre, dass das Fleisch der wahren menschlichen Natur fremd sei. Nachfolgende Theoretiker des Mönchtums – insbesondere Maximus der Bekenner – versuchten, die Lehren des Evagrius von unorthodoxen Elementen zu befreien, indem sie argumentierten, dass der ganze Mensch (und nicht nur seine Seele) durch die Kultivierung der Liebe zu Gott und dem Nächsten geheiligt werde. Dennoch blieb die orthodoxe Askese überwiegend kontemplativ. Im 14. Jahrhundert - hauptsächlich unter dem Einfluss der Lehren von Gregory Palamas - etabliert sich unter orthodoxen Mönchen der Hesychasmus, der vor allem eine besondere Gebetstechnik umfasst, die die Kontrolle der Atmung und eine längere geistige Konzentration auf ein kurzes an Jesus Christus gerichtetes Gebet impliziert (das sogenannte Jesusgebet). Nach den Lehren der Hesychasten ermöglicht diese Art von „klugem“ Gebet, spirituellen Frieden zu erlangen und führt später zu einer ekstatischen Betrachtung des göttlichen Lichts, das Christus im Moment seiner Verklärung umgab (Matthäus 17, 1-8).
Der Hesychasmus mag wie die klösterliche Spiritualität im Allgemeinen bewundert worden sein, aber es war unwahrscheinlich, dass er für gewöhnliche Menschen, die in einer Welt voller Arbeit und fleischlicher Liebe lebten und durch familiäre Bindungen lebten, zur üblichen Praxis werden würde. Die Kirche vernachlässigte jedoch ihr spirituelles Leben nicht, da für die Laien wie für das Mönchtum die Liturgie und die christlichen Sakramente das Zentrum der orthodoxen Religionsausübung waren. Die meisten orthodoxen Theologen erkennen sieben Sakramente an: Taufe, Firmung, Eucharistie, Priestertum, Ehe, Buße und Ölweihe. Da die Anzahl der Sakramente nicht offiziell von den ökumenischen Konzilen festgelegt wurde, wird den sieben aufgeführten Sakramenten manchmal das Sakrament der Klostertonsur hinzugefügt. Die sakramentale (sakramentale) Praxis der orthodoxen Kirche unterscheidet sich in vielen Details von der westlichen. Die Taufe erfolgt hier durch dreifaches Untertauchen, und in der Regel folgt unmittelbar darauf die Firmung, so dass das Sakrament der Firmung in der Orthodoxie am häufigsten an Säuglingen gespendet wird und nicht wie bei Katholiken an Kindern, die das Jugendalter erreicht haben. Im Sakrament der Buße wird der Reue über die Sünden und der geistlichen Führung des Beichtvaters eine größere Bedeutung beigemessen als dem Empfang einer formellen Absolution. In der Orthodoxie ist eine zweite Ehe verwitweter oder geschiedener Personen erlaubt, eine dritte wird verurteilt und eine vierte verboten. Zur kirchlichen Hierarchie gehören Bischöfe, Priester und Diakone. Orthodoxe Geistliche können unverheiratet sein, verheiratete Männer können jedoch auch zum Priestertum und zum Diakonat geweiht werden (was zur Voraussetzung wird, wenn sie nicht geweiht werden). Daher sind die meisten Gemeindepriester in der Regel verheiratet (obwohl sie im Falle einer Witwenschaft nicht wieder heiraten dürfen). ). Bischöfe müssen zölibatär sein und werden daher in der Regel aus der Mitte der Mönche gewählt. Die orthodoxe Kirche lehnt die Idee, Frauen zu ordinieren, besonders stark ab.
Das wichtigste aller christlichen Sakramente in der Orthodoxie ist das Sakrament der Eucharistie, und die eucharistische Liturgie ist das Zentrum des orthodoxen Gottesdienstes. Die Liturgie wird in der Kirche gefeiert, die in drei Teile gegliedert ist: das Vestibül, den Mittelteil und den Altar. Der Altar ist vom Rest der Kirche durch die Ikonostase getrennt – eine Barriere, auf der Ikonen (in der Orthodoxie werden keine skulpturalen Bilder verwendet) von Christus, der Jungfrau Maria, Heiligen und Engeln platziert sind. Die Ikonostase verfügt über drei Tore, die den Altar mit dem Mittelteil der Kirche verbinden. Die Liturgie beginnt mit Proskomedia, der Vorbereitung auf das Sakrament, bei der der Priester mit einem speziellen Messer („Speer“) Partikel von Prosphoras (aus Hefeteig gebacken) entfernt und roten Traubenwein und Wasser in eine Schüssel gießt. Anschließend wird die Liturgie der Katechumenen aufgeführt, zu der auch Gesangsgebete an die Heiligen gehören, deren Gedenken an diesem Tag gefeiert wird Trisagion-Lied(„Heiliger Gott, heiliger Mächtiger, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser“) und das Lesen des Apostels und des Evangeliums (d. h. der Texte aus den für diesen Tag bestimmten apostolischen Briefen und Evangelien). Danach wurde den Katechumenen (Katechumenen, also Menschen, die sich auf die Taufe vorbereiteten) in der Antike befohlen, die Kirche zu verlassen. Dann beginnt die Liturgie der Gläubigen. Die Heiligen Gaben – Brot und Wein – werden vom Klerus vor die Gemeindemitglieder getragen und zum Altar getragen, wo sie auf den Altar gelegt werden. Der Priester erinnert sich im Gebet an das letzte Abendmahl, bei dem Jesus Christus Brot und Wein in seinen Leib und sein Blut verwandelte. Danach wird eine Epiklese durchgeführt, in der der Priester gebeterfüllt den Heiligen Geist bittet, auf die Gaben herabzusteigen und sie zu verwandeln. Dann singen alle das Vaterunser. Schließlich empfangen die Gläubigen die Kommunion mit Teilchen transsubstantiierten Brotes, die mit einem Löffel („Lügner“) in einen Becher transsubstantiierten Wein getaucht werden. Das Wichtigste in der Liturgie ist dieser Akt der Gemeinschaft mit dem Leib und Blut Christi und der Einheit mit Christus.
Als höchstes Ziel des geistlichen Lebens gilt in der Orthodoxie die Gemeinschaft mit dem Leben Gottes. Bereits im Neuen Testament heißt es, dass das Ziel eines Christen darin besteht, „Teilhaber der göttlichen Natur“ zu werden (2. Petrus 1,4). Der heilige Athanasius von Alexandria (gest. 373) lehrte, dass „Gott Mensch wurde, damit der Mensch Gott werden konnte.“ Daher das Konzept der Vergöttlichung (Griechische Theose) nimmt einen zentralen Platz in der orthodoxen Tradition ein. Im Westen entwickelte Augustinus (gest. 430) die Lehre von der Erbsünde, wonach der menschliche Wille durch den Fall Adams erheblich geschädigt wurde und ein Mensch daher nur durch den Opfertod Christi der Hölle entkommen kann. Diese Lehre bleibt die Grundlage der katholischen und noch mehr der protestantischen Vorstellung von der Mission Christi und der Erlösung der Sünder. Die östliche Tradition hat jedoch keine ähnliche Lehre entwickelt. In der Orthodoxie wird die Inkarnation Christi eher als kosmisches Ereignis betrachtet: Durch die Inkarnation nimmt Gott alle materielle Realität in sich auf, und als Mensch eröffnet er allen Menschen die Möglichkeit, an seiner eigenen, göttlichen Existenz teilzuhaben. Der Gläubige wird die Fülle des göttlichen Lebens erst nach dem Tod im Himmel genießen können, aber der Beginn dieses Lebens ist die Annahme der Taufe, und dann wird es durch die Gemeinschaft der Heiligen Gaben im Sakrament der Eucharistie unterstützt. Nicholas Cabasilas (gest. 1395) schrieb, dass Christus uns in das himmlische Leben einführte, indem er den Himmel für uns neigte und ihn näher an die Erde brachte. Mönche nehmen ihre Kultivierung in diesem himmlischen Leben sehr ernst, aber alle orthodoxen Christen sind durch die Sakramente und die Liturgie dazu aufgerufen, an diesem Leben teilzunehmen.
Der orthodoxen Kirche wird manchmal vorgeworfen, dass sie den Angelegenheiten dieser Welt nicht genügend Aufmerksamkeit schenkt – auch denen, die direkt mit der Religion zu tun haben, insbesondere, dass die orthodoxe Kirche kein Interesse an missionarischen Aktivitäten hat. Wir müssen jedoch berücksichtigen, dass es der griechischen Kirche nach der Eroberung Konstantinopels durch die Türken im Jahr 1453 und dem anschließenden Untergang des Byzantinischen Reiches natürlich hauptsächlich darum ging, unter muslimischer Herrschaft zu überleben. Zuvor war sie jedoch sehr aktiv an der Christianisierung der kaukasischen Völker, insbesondere der Georgier, beteiligt. Darüber hinaus war sie maßgeblich an der Christianisierung der Slawen beteiligt. Die Heiligen Cyril (gest. 869) und Methodius (gest. 885) waren in der Missionsarbeit unter den Slawen der Balkanhalbinsel und später in Mähren tätig. Rus wurde während der Herrschaft des Fürsten Wladimir von Kiew (980–1015) zum Christentum konvertiert. Aufgrund dieser missionarischen Tätigkeit in der orthodoxen Kirche sind die Vertreter der slawischen Völker derzeit zahlreicher als die Griechen. Die Russisch-Orthodoxe Kirche, die der türkischen Herrschaft entkommen war, engagierte sich wiederum aktiv in der Missionsarbeit. So konvertierte Stefan von Perm (gest. 1396) das Komi-Volk zum Christentum, und es folgten Arbeiten bei anderen Völkern Nordeuropas und Asiens. Missionare der Russisch-Orthodoxen Kirche wurden 1715 in China und 1861 in Japan gegründet. Während Alaska zu Russland gehörte, arbeiteten Missionare auch im russischen Amerika.
Die orthodoxe Kirche hat stets auf ihre Beziehungen zu anderen christlichen Kirchen geachtet. Im Jahr 1274 und dann im Jahr 1439 wurde die Kirche des Byzantinischen Reiches unter der Autorität des Papstes offiziell mit der Westkirche vereint. Beide aus politischen Erwägungen hervorgegangenen und von der orthodoxen Bevölkerung auf Feindseligkeit gestoßenen Gewerkschaften waren erfolglos. Im 16. Jahrhundert Es begannen Kontakte zu protestantischen Theologen in Westeuropa, und Patriarch Cyril Lukary (gest. 1638) unternahm einen erfolglosen Versuch, der orthodoxen Theologie eine calvinistische Färbung zu verleihen. Im 19. Jahrhundert Es wurden Kontakte zu Altkatholiken gepflegt. Im 20. Jahrhundert Die Orthodoxe Kirche nimmt im Ökumenischen Rat der Kirchen eine aktive Position ein. Ein entscheidender Schritt vorwärts in der Entwicklung der Beziehungen zu den Katholiken war das Treffen des Patriarchen Athenagoras I. von Konstantinopel mit Papst Paul VI. im Jahr 1964 in Jerusalem. Im folgenden Jahr gaben sie eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie ihr Bedauern über die Entfremdung zwischen ihnen zum Ausdruck brachten der beiden Kirchen und der Hoffnung, dass die Unterschiede zwischen ihnen durch die Reinigung der Herzen, das Bewusstsein für historische Fehler und den festen Willen, zu einem gemeinsamen Verständnis und Bekenntnis des apostolischen Glaubens zu gelangen, überwunden werden können.
Die orthodoxe Kirche vereint heute vier alte Patriarchate (Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem) und weitere elf unabhängige (autokephale) Kirchen. Die höchste Position unter den Oberhäuptern der orthodoxen Kirchen nimmt traditionell der Patriarch von Konstantinopel ein, aber er ist nicht das alleinige Oberhaupt der gesamten orthodoxen Kirche. Orthodoxe Kirchen sind durch einen gemeinsamen Glauben und eine gemeinsame liturgische Praxis verbunden, verwalten ihre Angelegenheiten jedoch alle unabhängig voneinander. Nachfolgend sind die heute existierenden orthodoxen Kirchen aufgeführt.
Patriarchat von Konstantinopel.
Nach der türkischen Eroberung Konstantinopels (1453) erlitt die orthodoxe Hierarchie des ehemaligen Byzantinischen Reiches viele Nöte. Dennoch blieben die Patriarchen von Konstantinopel weiterhin an der Spitze der orthodoxen Kirche im Osmanischen Reich, und erst als sich Griechenland, Serbien, Rumänien und Bulgarien vom türkischen Joch befreiten, schwächten sich ihre religiösen Bindungen zum Patriarchat von Konstantinopel ab. Konstantinopel (heute Istanbul, Türkei) ist nach wie vor der wichtigste Bischofssitz der orthodoxen Welt, und der Bischof, der diesen Sitz innehat, trägt den Titel „ökumenischer Patriarch“, doch unter seiner Jurisdiktion befindet sich hauptsächlich nur die stark reduzierte orthodoxe Bevölkerung der Türkei. Was die griechischen Gebiete betrifft, so sind die unabhängige kretische Kirche (Insel Kreta) und die Dodekanes-Kirche (Inseln der südlichen Sporaden) Konstantinopel unterstellt. Darüber hinaus umfasst die direkte Unterstellung des Patriarchen von Konstantinopel die Klöster auf dem Berg Athos, einem selbstverwalteten Territorium innerhalb Griechenlands. Der Patriarch beaufsichtigt auch griechische Kirchen im Ausland, von denen die größte die Griechisch-Orthodoxe Kirche Amerikas mit Sitz in New York ist. Auch kleine autonome orthodoxe Kirchen in Finnland und Japan unterliegen der Gerichtsbarkeit von Konstantinopel.
Patriarchat von Alexandria.
Der antike Bischofssitz von Alexandria präsidiert das spirituelle Leben der kleinen griechischen Gemeinde in Ägypten. Allerdings im 20. Jahrhundert. Viele Konvertiten schlossen sich der Kirche von Alexandria in den Ländern Äquatorialafrikas an – in Kenia, Uganda, Tansania usw. Im Jahr 1990 gab es unter der Gerichtsbarkeit des Patriarchen von Alexandria ca. 300.000 Gläubige.
Patriarchat von Antiochia.
Unter der Jurisdiktion des Patriarchen von Antiochia, dessen Residenz sich in Damaskus (Syrien) befindet, gab es 1990 ca. 400.000 orthodoxe Gläubige, davon etwa die Hälfte arabischsprachige Syrer und die andere Hälfte aus der syrischen Diaspora in Amerika.
Jerusalemer Patriarchat.
Im Jahr 1990 betrug die Herde des Patriarchen von Jerusalem ca. 100.000 christliche Araber aus Jordanien, Israel und den von Israel besetzten Gebieten.
Russisch-Orthodoxe Kirche.
Das Christentum wurde in Russland Ende des 10. Jahrhunderts angenommen. Anfänglich wurde die Kirche von den Kiewer Metropoliten geleitet, und das wichtigste Zentrum des Mönchtums war die Kiewer Höhlenkloster. Allerdings im 14. und 15. Jahrhundert. das Zentrum des politischen Lebens verlagerte sich nach Norden. Im Jahr 1448 entstand eine unabhängige Metropole Moskau, und Kiew behielt nur die Gebiete der heutigen Ukraine und Weißrusslands unter seiner Gerichtsbarkeit. Die von Sergius von Radonesch (gest. 1392) gegründete Lavra der Heiligen Dreifaltigkeit von Sergius (Sergiev Posad) wurde zu einem der Hauptzentren der russischen spirituellen Kultur.
Die russischen Kirchenführer waren sich der besonderen Rolle ihres Volkes als zahlreichstes aller orthodoxen Völker bewusst. Es entstand die Theorie von Moskau als dem „Dritten Rom“: Nach dieser Theorie fiel Rom selbst unter der Herrschaft der Päpste von der Orthodoxie ab, Konstantinopel – das „zweite Rom“ – fiel unter den Ansturm der Türken, und so wurde Moskau zum großes Zentrum der gesamten orthodoxen Welt. Im Jahr 1589 wurde das Moskauer Patriarchat gegründet – das erste neue Patriarchat seit der Ära der alten Kirche.
In der Zwischenzeit wurde die Ukraine Teil des polnisch-litauischen Commonwealth und der Kiewer Metropolit begann, sich nicht Moskau, sondern Konstantinopel zu unterwerfen. Im Jahr 1596 wurde die Brester Union geschlossen, in deren Folge viele Ukrainer Katholiken wurden. Orthodoxe Ukrainer kehrten im 17. und 18. Jahrhundert nach der Wiedervereinigung der Ukraine mit Russland in die Gerichtsbarkeit Moskaus zurück.
Nach der von Patriarch Nikon im Jahr 1653 durchgeführten Kirchenreform, die die russische liturgische Praxis an die griechische anpassen sollte, trennten sich Gegner dieser Reformen von der russisch-orthodoxen Kirche, die man Altgläubige oder Schismatiker nannte. Die Altgläubigen wurden in Priester (die Priester hatten), Bespopovtsy (die keine Priester hatten) und Beglopopovtsy (die selbst keine Priester ordinierten, sondern Priester akzeptierten, die bereits in der orthodoxen Kirche geweiht waren und sich den Altgläubigen anschließen wollten) unterteilt ).
Im Laufe der Zeit begannen die russischen Zaren in der russisch-orthodoxen Kirche die gleiche Rolle zu spielen wie zuvor die byzantinischen Kaiser. Im Jahr 1721 schaffte Peter der Große das Patriarchat ab, um eine engere Verzahnung der Kirche mit dem neuen Verwaltungssystem zu erreichen. Im 18. und 19. Jahrhundert. Das zaristische Regime zwang die ukrainischen Katholiken auf dem Territorium des Russischen Reiches, der orthodoxen Kirche beizutreten. Darüber hinaus erklärten sich die russischen Zaren zu Beschützern aller orthodoxen Christen außerhalb Russlands, von denen Millionen Untertanen des Osmanischen Reiches waren.
Trotz strenger staatlicher Kontrolle führte die Russisch-Orthodoxe Kirche weiterhin ein intensives spirituelles Leben. Seraphim von Sarow (gest. 1833) war der Initiator der großen spirituellen Wiederbelebung in Russland im 19. Jahrhundert. Johannes von Krostadt (gest. 1909) unternahm erhebliche Anstrengungen, um die ärmsten Bevölkerungsschichten an kirchliche Sakramente und Gottesdienste heranzuführen. Im 19. Jahrhundert Die Orthodoxie zog viele Vertreter der russischen Intelligenz an.
1917, nach dem Sturz der zaristischen Macht, wurde das Patriarchat in Russland wiederhergestellt und ein neuer Patriarch von Moskau und ganz Russland gewählt. Die Sowjetregierung schränkte die Aktivitäten der Kirche ein, verhaftete und hinrichtete Geistliche und startete groß angelegte atheistische Propaganda. Tausende Kirchen und Klöster wurden geschlossen, viele zerstört und einige in Museen umgewandelt. Der Sturz des Zarismus veranlasste die Ukrainer zu dem Versuch, eine lokale autokephale Kirche zu gründen, doch die sowjetischen Behörden unterdrückten diesen Versuch.
Während des Zweiten Weltkriegs änderte der Staat seine Haltung gegenüber der Kirche. Orthodoxie wird in Russland traditionell mit patriotischer Ideologie in Verbindung gebracht, und die Führung des Landes zog die Kirche heran, um das Volk aufzurütteln, das „Heilige Russland“ gegen die Nazi-Invasoren zu verteidigen. Die Situation der Kirche wurde Ende der 1950er Jahre erneut recht schwierig.
Ende der 1980er Jahre nahm die Kirche unter M. S. Gorbatschow eine stärkere Position ein. Der Zusammenbruch des Sowjetsystems im Jahr 1991 eröffnete neue Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten, stellte es aber auch vor neue Probleme, die mit der drohenden Übernahme der neuen Werte der westlichen Konsumgesellschaft durch Russland verbunden waren. Darüber hinaus führte die Weigerung, Manifestationen des nationalistischen Geistes zu unterdrücken, zu einer Konfrontation mit der Russisch-Orthodoxen Kirche in der Ukraine. Die Unierten (Katholiken des östlichen Ritus) der Westukraine, die 1946 der orthodoxen Kirche angegliedert wurden, erlangten 1990 ihre Unabhängigkeit und bildeten die Ukrainische Griechisch-Katholische Kirche; Ein Teil des Kircheneigentums und der Gebäude wurde ihnen zurückgegeben. Im Jahr 1998 waren auf dem Territorium der Ukraine Pfarreien der Ukrainischen Orthodoxen Kirche des Kiewer Patriarchats (UOC-KP), der Ukrainischen Autokephalen Orthodoxen Kirche (UAOC) und der Ukrainischen Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats (UOC-MP) tätig. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen der UOC-KP und der UAOC über die Vereinigung zur Ukrainischen Lokalorthodoxen Kirche unter patriarchaler Kontrolle.
Die Russisch-Orthodoxe Kirche (ROK) unter der Leitung des Patriarchen von Moskau und ganz Russland (seit 1990 Alexi II.) vereint in ihrem Schoß einen bedeutenden Teil der Bevölkerung der ehemaligen Sowjetunion. Es ist unmöglich, die genaue Zahl der orthodoxen Gläubigen zu nennen (wahrscheinlich 80–90 Millionen). Im Jahr 1999 hatte die Russisch-Orthodoxe Kirche 128 Diözesen (1989 - 67), mehr als 19.000 Pfarreien (1988 - 6893) und 480 Klöster (1980 - 18). Die Zahl der Altgläubigen-Priester unter der Führung des Erzbischofs von Moskau beträgt etwa 1 Million Menschen. Bespopovtsy, Teil vieler unabhängiger Gemeinden, zählt ebenfalls ca. 1 Million. Und die Zahl der Altgläubigen-Beglopopoviten umfasst ca. 200.000 Gläubige. Die Zusammenarbeit des Moskauer Patriarchats mit den sowjetischen Behörden führte zur Abspaltung des rechten Flügels der Kirche von ihm, der die Russisch-Orthodoxe Auslandskirche (Russische Auslandskirche) bildete; 1990 zählte diese Kirche ca. 100.000 Mitglieder. Im Mai 2007 unterzeichneten der Patriarch von Moskau und ganz Russland, Alexi II., und der Erste Hierarch der Russischen Auslandskirche, Metropolit Laurus, das Gesetz über die kanonische Kommunion, das Normen für die Beziehungen zwischen den beiden orthodoxen Kirchen festlegte und auf die Wiederherstellung der Einheit abzielte Russisch-Orthodoxe Kirche.





Rumänisch-orthodoxe Kirche.
Rumänen sind das einzige romanische Volk, das sich zur Orthodoxie bekennt. Die rumänische Kirche erhielt 1885 den autokephalen Status und wird seit 1925 vom Patriarchen von Bukarest geleitet. Im Jahr 1990 waren es ca. 19 Millionen Mitglieder.
Orthodoxe Kirche Griechenlands.
Syrisch-orthodoxe (jakobitische) Kirche.
Religiöses Leben in Syrien im 5.–6. Jahrhundert. durchlief fast die gleiche Entwicklung wie in Ägypten. Die Mehrheit der lokalen syrischsprachigen Bevölkerung akzeptierte die Lehren der Monophysiten, was vor allem auf die Feindseligkeit gegenüber den hellenisierten Landbesitzern und Stadtbewohnern sowie gegenüber dem griechischen Kaiser in Konstantinopel zurückzuführen war. Obwohl der prominenteste syrische monophysitische Theologe Severus von Antiochia (gest. 538) war, spielte James Baradai (500–578) eine so wichtige Rolle beim Bau der monophysitischen Kirche in Syrien, dass sie als jakobitische Kirche bezeichnet wurde. Anfangs war die Bevölkerung Syriens überwiegend christlich, später konvertierte die Mehrheit der Bevölkerung zum Islam. Im Jahr 1990 zählte die Syrische Jakobitenkirche ca. 250.000 Mitglieder leben hauptsächlich in Syrien und im Irak. An der Spitze steht der jakobitische Patriarch von Antiochia, dessen Residenz in Damaskus (Syrien) liegt.
Malabar Jacobite oder syrisch-orthodoxe (jakobitische) Malankara-Kirche.
Der Legende nach wurde das Christentum durch den Apostel Thomas nach Indien gebracht. Bis zum 6. Jahrhundert. Nestorianische Gemeinschaften existierten bereits im Südwesten Indiens. Mit dem Niedergang der Nestorianischen Kirche wurden diese Christen zunehmend unabhängig. Im 16. Jahrhundert Unter dem Einfluss portugiesischer Missionare wurden einige von ihnen katholisch. Versuche, indische Christen an die westliche Religionspraxis heranzuführen, lösten jedoch im 17. Jahrhundert bei vielen Proteste aus. diejenigen Gläubigen, die der römisch-katholischen Kirche nicht beitreten wollten, wurden Jakobiten. Die Malabar-Jakobitenkirche wird vom Katholikos des Ostens mit Sitz in Kottayam geleitet und zählt im Jahr 1990 ca. 1,7 Millionen Mitglieder.
Malabar Syrische Kirche St. Thomas, die sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter dem Einfluss anglikanischer Missionare von der Jakobitenkirche trennte, zählte ca. 700.000 Mitglieder.
Armenische Apostolische Kirche.
Im Jahr 314 erklärte Armenien als erstes Land das Christentum zur Staatsreligion. Nach der Verurteilung des Monophysitismus im Jahr 451 ließen die christologischen Streitigkeiten in Armenien nicht nach, und im Jahr 506 nahm die armenische Kirche offiziell eine antichalcedonische Position ein. Im 12. Jahrhundert Nerses der Gnädige erklärte, dass die christologische Lehre der armenischen Kirche in keiner Weise der Lehre des Konzils von Chalkedon widerspreche; Tatsächlich waren die Armenier in viel geringerem Maße der monophysitischen Lehre verpflichtet als beispielsweise äthiopische Christen. Die armenische Kirche überlebte trotz der brutalen Massaker der Türken im Ersten Weltkrieg und des Atheismus der Sowjetzeit. Im Jahr 1990 zählte die armenische Kirche ca. 4 Millionen Mitglieder in Armenien selbst und auf der ganzen Welt. Das Oberhaupt der Kirche ist der Patriarch-Katholikos.
ÖSTLICHE KATHOLISCHE KIRCHEN
Die römisch-katholische Kirche umfasst 22 „Riten“, die sechs Gruppen bilden. Dabei handelt es sich um den lateinischen Ritus, dem weltweit 90 % der Katholiken angehören, den byzantinischen Ritus, den alexandrinischen Ritus, den antiochenischen Ritus, den ostsyrischen Ritus und den armenischen Ritus. Gläubige aller katholischen Riten halten an demselben Glaubensbekenntnis fest und erkennen die Autorität des Papstes an, aber jeder Ritus behält seine eigenen liturgischen Traditionen, seine eigene Kirchenorganisation und seine eigene Spiritualität bei, die weitgehend mit denen der entsprechenden nichtkatholischen Kirchen identisch sind. Beispielsweise behalten Katholiken des östlichen Ritus die Institution des verheirateten Priestertums bei, da das zölibatäre Priestertum ein charakteristisches Merkmal der Kirchendisziplin der Katholiken des lateinischen Ritus und kein Gegenstand der katholischen Lehre ist. Katholiken der östlichen Riten werden oft Uniaten genannt, aber dieser Name wird als beleidigend angesehen. Katholiken des östlichen Ritus genießen große Freiheit bei der Verwaltung ihrer Angelegenheiten, da der Papst einige seiner Befugnisse gegenüber der lateinischen Kirche als Patriarch des Westens und nicht als Papst ausübt.
Byzantinische Riten.
Katholiken des byzantinischen Ritus leben im Nahen Osten und in Osteuropa sowie in ausgewanderten Gemeinden auf der ganzen Welt. Der melchitische Ritus entstand 1724 nach der umstrittenen Wahl des Patriarchen von Antiochia. Seitdem halten einige der Melchiten an der Orthodoxie fest, und der andere Teil trat der römisch-katholischen Kirche bei. Das Wort „Melchiten“ (oder „Melkiten“) bedeutet „Royalisten“ und wurde verwendet, um Kirchen zu bezeichnen, die sich zum gleichen Glauben bekennen wie die byzantinischen Herrscher – im Gegensatz beispielsweise zu den Kopten und Jakobiten. An der Spitze der Melchitischen Kirche steht der Patriarch von Antiochia, der in Damaskus lebt und im Jahr 1990 ca. 1 Million Gläubige.
Infolge der Union von Brest im Jahr 1596 schlossen sich viele Ukrainer der römisch-katholischen Kirche an. Diejenigen von ihnen, die in den Gebieten lebten, die im 18. Jahrhundert Teil des Russischen Reiches wurden, wurden auf Druck der zaristischen Behörden zur Orthodoxie zurückgeführt, aber die Ukrainer, die auf dem Territorium des Österreichischen Reiches (in Galizien) lebten, wurden Katholiken Ukrainischer Ritus und diejenigen, die im ungarischen Königreich lebten - Katholiken des ruthenischen Ritus. Später kam Galizien unter polnische Herrschaft, wo am Vorabend des Zweiten Weltkriegs ca. 3–5 Millionen ukrainische Katholiken. Sie lebten hauptsächlich in Gebieten, die in den 1940er Jahren von der Sowjetunion annektiert und gewaltsam der russisch-orthodoxen Kirche angegliedert wurden. An der Spitze der Kirche des Ukrainischen Ritus steht der Erzbischof von Lemberg. Viele Ukrainer in den USA und Kanada gehören ihr an, und derzeit werden Anstrengungen unternommen, um sie in der postsowjetischen Ukraine wiederherzustellen. Auch die Kirche des Ruthenischen Ritus, an deren Spitze der Erzbischof von Pittsburgh steht, gehört überwiegend Auswanderern. Historisch gesehen hatten die ihnen nahestehenden ungarischen, slowakischen und jugoslawischen Riten im Inland im Allgemeinen ein wohlhabenderes Schicksal. Insgesamt machten diese fünf Rituale ca. 2,5 Millionen aktive Gläubige.
Katholiken des rumänischen Ritus gibt es seit 1697, als Siebenbürgen Teil Ungarns wurde, und zählten ca. 1,5 Millionen Menschen, bis sie 1948 gewaltsam der Rumänisch-Orthodoxen Kirche angegliedert wurden.
Im Jahr 1990 umfasste der italienisch-albanische Ritus ca. 60.000 Gläubige; Dabei handelt es sich um Christen des byzantinischen Ritus, die in Süditalien und Sizilien leben und seit jeher Katholiken sind.
Alexandrische Riten.
Koptische Katholiken und äthiopische Katholiken halten sich an einen Ritus, der auf die alexandrinische Tradition zurückgeht. Die koptischen Katholiken werden vom katholischen koptischen Patriarchen von Alexandria angeführt, und im Jahr 1990 gab es ca. 170.000. Die Zahl der Katholiken des äthiopischen Ritus unter der Leitung ihres eigenen Erzbischofs in Addis Abeba belief sich im Jahr 1990 auf etwa 170.000. 120.000 Menschen.
Antiochische Riten.
Drei bedeutende Gruppen von Katholiken halten in ihrer Religionsausübung an westsyrischen Riten fest, die auf die antiochenische Tradition zurückgehen. Durch die Vereinigung der Syro-Jakobiten mit Rom im Jahr 1782 entstand der syrische Ritus. An der Spitze der Katholiken des syrischen Ritus, deren Zahl im Jahr 1990 ca. 100.000 kostet der katholische syrische Patriarch von Antiochia, dessen Sitz sich in Beirut befindet. Mar Ivanios, ein jakobitischer Bischof im Südwesten Indiens, wurde 1930 katholisch; Seinem Beispiel folgten Tausende Jakobiten, die 1932 den Status von Katholiken des Malankara-Ritus erhielten. Der Sitz ihres Erzbischofs ist Trivandra, und 1990 zählten sie ca. 300.000.
Katholiken des maronitischen Ritus haben ihren Ursprung im alten Syrien. Einst St. Maro (gest. 410?) gründete ein Kloster in Nordsyrien, dessen Mönche eine wichtige Rolle bei der Christianisierung der lokalen Bevölkerung und dem Bau einer Kirche spielten, was nach der muslimischen Eroberung Syriens im 7. Jahrhundert zu einer schwierigen Aufgabe wurde. Der Legende nach wurde der erste maronitische Patriarch im Jahr 685 gewählt. Im 8. und 9. Jahrhundert. Die maronitische Gemeinschaft zog nach und nach von Nordsyrien in den Libanon. Die Maroniten unterhielten fast keine Kontakte zu anderen Christen, und ihre Lehre wies eine sichtbare monothelitische Voreingenommenheit auf, was durch ihre Unkenntnis der Entscheidungen des Dritten Konzils von Konstantinopel erklärt wurde. Als die Kreuzfahrer in den Libanon kamen, kamen die Maroniten mit westlichen Christen in Kontakt. 1180–1181 erkannten die Maroniten Papst Alexander III. an. Sie blieben Katholiken in einem überwiegend muslimischen Umfeld und bildeten, obwohl sie Arabisch sprachen, eine deutliche nationale Minderheit und hatten ihre eigenen Traditionen. Derzeit spielen die Maroniten eine herausragende Rolle im politischen Leben des Libanon. Der Einfluss des lateinischen Ritus ist in der Liturgie und den Regeln der Maroniten spürbar. An der Spitze der maronitischen Kirche steht der maronitische Patriarch von Antiochien, dessen Residenz sich in der Nähe von Beirut befindet. Im Jahr 1990 waren es ca. 2 Millionen Maroniten im Libanon, in anderen Ländern des Nahen Ostens und unter libanesischen Auswanderern auf der ganzen Welt.
Ostsyrische Riten.
Zu den Katholiken des ostsyrischen Ritus zählen Katholiken der chaldäischen und malabarischen Kirche. Die chaldäisch-katholische Kirche entstand 1553, als es zu einer Spaltung der Nestorianerkirche kam und ein Teil von ihr die Autorität des Papstes anerkannte. Im Jahr 1990 besaß es ca. 600.000 Gläubige. Die meisten von ihnen leben im Irak, wo sie die größte christliche Gemeinschaft bilden. Christen der Nestorianischen Kirche im Südwesten Indiens, die im 16. Jahrhundert katholisch wurden, werden Malabar-Katholiken genannt. Die Malabar-Liturgie und das kirchliche Leben tragen den Stempel eines starken lateinischen Einflusses. Die Malabar-Katholiken werden von den Erzbischöfen von Ernakulam und Changanacherya geführt, und im Jahr 1990 zählte diese Kirche etwa 1000 Mitglieder. 2,9 Millionen Mitglieder.
Armenischer Ritus.
Die Union der armenischen Christen mit der römisch-katholischen Kirche bestand von 1198 bis 1375. Diese Union begann während der Kreuzzüge, als die Armenier Verbündete der Lateiner im Kampf gegen die Muslime wurden. Der moderne armenische Ritus entstand 1742. Armenische Katholiken, insbesondere die Benediktiner-Mekhitariten-Mönche, leisteten bedeutende Beiträge zur armenischen Kultur, indem sie Bücher veröffentlichten und Schulen gründeten. An der Spitze der Katholiken des armenischen Ritus steht der Patriarch von Kilikien, dessen Residenz sich in Beirut befindet. Im Jahr 1990 waren es ca. 150.000 in verschiedenen Ländern des Nahen Ostens.
Literatur:
Posnov M.E. Geschichte der christlichen Kirche(vor der Kirchenteilung - 1054). Kiew, 1991
Schmeman A. Der historische Weg der Orthodoxie. M., 1993
Christentum. Enzyklopädisches Wörterbuch, Bd. 1–3. M., 1993–1995
Bolotov V.V. Vorträge zur Geschichte der Alten Kirche, Bde. 1–3. M., 1994
Christentum: Wörterbuch. M., 1994
Pospelovsky D.V. Russisch-Orthodoxe Kirche im 20. Jahrhundert. M., 1995
Völker und Religionen der Welt. Enzyklopädie. M., 1998
Die Kirche entstand 1924 in Polen als Versuch, polnisch-orthodoxe Gläubige in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Stuhl zu bringen. Derzeit heißt diese Kirche in Polen Neounia. Es arbeitet parallel mit zwei Diözesen der UGCC in Polen. Die Zahl der Gläubigen beträgt mehrere Tausend Menschen.
Enzyklopädisches YouTube
1 / 1
7. Orthodoxie in Russland (Orthodoxie in Russland)
Untertitel
Zu Beginn des 14. Jahrhunderts wurde Moskau zur eigentlichen Hauptstadt der Metropole. Wladimir blieb immer noch die offizielle Residenz der Metropoliten von Kiew und ganz Russland, aber Metropolit Peter verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in Moskau. Auf seinen Wunsch hin wurde 1326 im Moskauer Kreml die Mariä Himmelfahrt-Kathedrale aus weißem Stein gegründet. Eineinhalb Jahrhunderte später baute der italienische Architekt Aristoteles Fioravanti an derselben Stelle einen neuen majestätischen Tempel – die Kathedrale der Moskauer Metropoliten. Während der Herrschaft von Iwan I. Kalita kam es zur Vereinigung der russischen Länder rund um Moskau. Auch die Metropole wurde hierher verlegt. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wurde Moskau zum Zentrum des bewaffneten Kampfes gegen das mongolisch-tatarische Joch. Eine wichtige Rolle in dieser Zeit im kirchlichen und politischen Leben der Rus spielte ein Zeitgenosse des heiligen Sergius von Radonesch, Metropolit Alexi von Moskau. Schon in seiner Jugend strebte er als Sohn eines Bojaren ein klösterliches Leben an im Alter von zwanzig Jahren legte er die Mönchsgelübde ab. Im Jahr 1354 genehmigte Patriarch Philotheus Kokkin von Konstantinopel Alexius als Metropolit von ganz Russland, obwohl dies ausnahmsweise geschah: Es gab eine Regel – ethnische Griechen wurden in die russische Metropole berufen. Unter Fürst Iwan II. von Moskau leitete der Heilige Alexi tatsächlich die Außenpolitik. Der Metropolit trug zur Schaffung einer Union russischer Fürstentümer bei, um der Goldenen Horde entgegenzutreten, die zu diesem Zeitpunkt bereits erheblich geschwächt war. Der Mönch Sergius von Radonesch war ein jüngerer Zeitgenosse und spiritueller Freund des Heiligen Alexy. Auch er stammte aus einer Bojarenfamilie und zeichnete sich seit seiner Kindheit durch tiefe Frömmigkeit aus. Nach dem Tod seiner Eltern gingen er und sein älterer Bruder Stefan in die Wälder in der Nähe von Moskau und errichteten zwölf Meilen vom Dorf Radonesch entfernt eine Zelle und dann eine kleine Kirche im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit. Stefan konnte den harten Bedingungen nicht standhalten, verließ seinen Bruder und zog in das Moskauer Dreikönigskloster. Nachdem er mehrere Jahre allein gelebt hatte, begann der heilige Sergius, Jünger aufzunehmen. Im Jahr 1354 wurde er zum Hieromonk geweiht und zum Abt des von ihm gegründeten Klosters ernannt. Der Ruhm des heiligen Sergius, dem die Gabe des Hellsehens und der Wunder verliehen wurde, wuchs von Tag zu Tag. Zu seinen Bewunderern zählten Fürsten, Bojaren, Bischöfe und Priester. Vor der entscheidenden Schlacht kam der edle Fürst Dimitri Donskoi zum Hl. Sergius um Rat und Segen. Die unter seinem Kommando stehende russische Armee musste der Invasion des mongolischen Khan Mamai widerstehen. In diesem für Russland kritischen Moment waren Staat und Kirche vereint. Der Mönch Sergius segnete Dmitry Donskoy, sagte seinen Sieg voraus und stellte ihm zwei Mönche seines Klosters zur Hilfe – die Schemamonks Andrei Oslyabya und Alexander Peresvet. Beide Mönche kämpften zusammen mit dem Großfürsten und seiner Armee heldenhaft gegen die Truppen von Mamai und am 8. September 1380 errang die russische Armee einen Sieg auf dem Kulikovo-Feld. Diese historische Schlacht markierte den Beginn der Befreiung Russlands vom tatarisch-mongolischen Joch. Die Verehrung des Heiligen Sergius begann zu seinen Lebzeiten und dauerte auch nach seinem Tod an. Sie begannen, ihn „Abt des russischen Landes“ zu nennen. Das von ihm gegründete Kloster wuchs schnell und erlangte für die Moskauer Rus die gleiche Bedeutung wie die Lawra des Heiligen Antonius und Theodosius von Petschersk für die Kiewer Rus. Bis heute ist die Dreifaltigkeits-Sergius-Lavra des Heiligen Sergius das erste und bedeutendste Kloster der russischen Kirche, in dem sich Dutzende Bischöfe, Hunderte Geistliche und Tausende Laien an den Gedenktagen des Heiligen versammeln. Unter Metropolit Jona begann eine neue Periode im Leben der russischen Kirche. Nach seiner Wahl in die Moskauer Metropole musste er als Russe zur Genehmigung nach Konstantinopel reisen. Allerdings verhinderten zunächst politische Umstände dies, und dann ging das Patriarchat von Konstantinopel eine Union mit den Lateinern ein. Unter diesen Bedingungen beruft Großherzog Wassili II. einen Rat ein, um ohne Zustimmung Konstantinopels einen Metropoliten von ganz Russland einzusetzen. Infolgedessen wurde Jona 1448 Metropolit. Dies markierte tatsächlich den Beginn der Autokephalie der russischen Kirche. Nachfolgende russische Metropoliten wurden ohne Zustimmung des Metropoliten von Konstantinopel ernannt. Die politische Macht Russlands wird weiter gestärkt. In der Zeit von der Mitte des 15. bis zum Ende des 16. Jahrhunderts schlossen sich die alten Fürstentümer – Jaroslawl, Rostow, Nowgorod, Twer, Pskow, Rjasan – nacheinander Moskau an. Im Jahr 1472 heiratete Großherzog Johannes III. Wassiljewitsch die griechische Prinzessin Sophia Paleologus, was ihm in den Augen des russischen Volkes zusätzliche Legitimität als orthodoxer Autokrat und Erbe der byzantinischen Kaiser verlieh. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde die Moskauer Theorie des 3. Roms entwickelt, die insbesondere vom Ältesten des Pskower Spaso-Eliazar-Klosters, dem Mönch Philotheus, formuliert wurde. „Das erste Rom fiel vor der Bosheit, das zweite (Konstantinopel) vor der Herrschaft der Agarier, das dritte Rom – Moskau, und das vierte wird nicht existieren.“ Die Mitte des 16. Jahrhunderts war in der Geschichte der russischen Kirche von Streitigkeiten zwischen „Erwerbstätigen“ und „Nichterwerbstätigen“, Befürwortern und Gegnern des klösterlichen Grundbesitzes geprägt. Zu dieser Zeit gab es in Russland viele Klöster, die in Gemeinschafts- und Sonderklöster unterteilt waren. In Gemeinschaftsklöstern lag der Schwerpunkt auf asketischen Taten, Gehorsam, Gemeinschaftsgebet und Nächstenliebe; Im Besonderen – zum Thema „Smart Doing“ und Abkehr von der Welt. Die Statuten dieser und anderer Klöster schrieben Habgierfreiheit vor, jedoch konnten sowohl Zönobiten- als auch Sonderklöster Land, Dörfer und Bauern besitzen und Einkommen erzielen. Eigentümer des Landes waren auch Diözesen und Pfarreien. Der Hauptideologe des kirchlichen Grundbesitzes zu Beginn des 16. Jahrhunderts war der Mönch Joseph von Wolotski. Er glaubte, dass der Besitz von Land und Immobilien der Kirche Unabhängigkeit von der weltlichen Macht verschaffte und die Möglichkeit für wohltätige Aktivitäten eröffnete. „In Zeiten der Hungersnot öffnet Joseph die Getreidespeicher des Klosters weit, ernährt täglich bis zu siebenhundert Menschen und versammelt bis zu fünfzig von ihren Eltern verlassene Kinder in der von ihm gebauten Unterkunft. Wenn es kein Brot gibt, befiehlt er zu kaufen, es gibt kein Geld – zum Ausleihen und „Geben von Manuskripten“ – „damit niemand das Kloster verlässt, ohne zu essen.“ Die Mönche murren: „Sie werden uns töten, aber sie werden nicht gefüttert.“ Aber Joseph überredet sie, geduldig zu sein.“ Georgi Fedotow. Heilige des alten Russlands Der ideologische Gegner von Joseph von Wolotsky war der Mönch Nil von Sorsky. Er schlug vor, „dass es keine Dörfer in der Nähe der Klöster geben sollte, sondern dass die Mönche in der Wüste leben und sich von Kunsthandwerk ernähren sollten.“ Der Mönch Nil gehörte zur spirituellen Tradition, die im 14. Jahrhundert von den athonitischen Hesychastenmönchen in Byzanz verkörpert wurde. In seiner Jugend besuchte er den Berg Athos und gründete nach seiner Rückkehr nach Russland ein kleines Kloster am Fluss Sora, wo er sein ganzes Leben mit asketischer Arbeit und literarischen Aktivitäten verbrachte. Das Moskauer Konzil von 1503 stellte sich auf die Seite Josephs von Wolotski. Nach dem Tod des Heiligen, bereits im 16. Jahrhundert, wurde er feierlich heiliggesprochen. Der Name Nil Sorsky wurde erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Kalender aufgenommen. Charakteristisch ist das Schicksal des geistlichen Erben der „Nichtbesitzer“ – des Mönchs Maxim des Griechen. Als sich Großherzog Wassili III. mit der Bitte an Konstantinopel wandte, einen Wissenschaftler zu entsenden, um Übersetzungen des Erklärenden Psalters und anderer Bücher zu vergleichen, fiel die Wahl auf den Mönch des Athos-Vatopedi-Klosters Maxim. Da er die russische Sprache nicht beherrschte, übersetzte er ins Lateinische und von lateinischen Dolmetschern – Gerichtsübersetzern – ins Russische: Diese Methode konnte natürlich keine qualitativ hochwertige Übersetzung gewährleisten. Nach Abschluss seiner Arbeit wollte Maxim nach Griechenland zurückkehren, wurde jedoch mit der Arbeit am Erläuternden Apostel und den slawischen liturgischen Büchern beauftragt: Der Vergleich ergab zahlreiche Fehler. Im Laufe der Zeit lernte Maxim Russisch und geriet in einen Streit zwischen Geldgierigen und Nicht-Geldgierigen, wobei er sich entschieden auf die Seite der Letzteren stellte. Diese Aktivität sorgte vor Gericht für Unmut. Sie begannen, nach Fehlern in den Übersetzungen und Häresien in seinen Aussagen zu suchen. All dies führte zur Verurteilung Maxims des Griechen auf dem Konzil. Maxim beantragte seine Freilassung in das Vatopedi-Kloster, doch stattdessen wurde er exkommuniziert und zunächst in das Joseph-Wolotski-Kloster (die Hauptfestung der „Geldräuber“) verbannt. ) und dann zum Kloster Tver Otroch. Nur 22 Jahre später, am Ende seines Lebens, erhielt er die Erlaubnis, sich in der Dreifaltigkeits-Sergius-Lavra niederzulassen, wo er starb und begraben wurde. Hier bleiben bis heute seine heiligen Reliquien, die in unserer Zeit gefunden wurden, als der Mönch Maxim unter den Heiligen verherrlicht wurde. Im Jahr 1547 krönte der Moskauer Metropolit Macarius den 16-jährigen Iwan IV. Wassiljewitsch, der später den Spitznamen „Der Schreckliche“ erhielt, auf den Thron. Die ersten Regierungsjahre des Großherzogs waren von großen militärischen und politischen Erfolgen geprägt: 1552 wurde Kasan eingenommen, vier Jahre später Astrachan und dann Polozk. Das Volk versammelte sich um den Zaren, in dem es einen aufrichtigen Verteidiger des orthodoxen Glaubens und einen Garanten der staatlichen Integrität sah. Doch kurz nach dem Tod des Metropoliten Macarius kam es zu einer drastischen Veränderung in den Aktivitäten des Zaren. Iwan IV. verließ Moskau und ließ sich in Aleksandrovskaya Sloboda nieder, wo er eine Art Kloster gründete, das er selbst leitete. Anfang 1565 gründete der Zar die Opritschnina. Die Aufgabe dieser Straforganisation bestand darin, mögliche politische Verschwörungen aufzudecken und die Verschwörer zu vernichten. Die Hinrichtungen begannen. Viele Bojaren und ihre Familien wurden des Hochverrats verdächtigt und verbannt. Ihr Eigentum ging in die Hände von Iwan dem Schrecklichen und den Gardisten über. Das äußere Unterscheidungsmerkmal der Gardisten des Zaren war ein Hundekopf und ein am Sattel befestigter Besen, was bedeutete, dass sie nagende und fegende Verräter waren. Nach dem Willen des Autokraten wurde 1566 der Solowezki-Hegumen Philipp aus der Bojarenfamilie der Kolychevs ernannt zum Metropoliten von Moskau gewählt. Zuerst allein mit dem Zaren und dann öffentlich begann der heilige Philipp, seine Ablehnung der Teilung des Landes in die Opritschnina – die königlichen Bojaren, und die Zemshchina – alle anderen Bojaren mit ihren Höfen – zum Ausdruck zu bringen. Der Metropolit protestierte gegen die Grausamkeiten Iwans des Schrecklichen. Im März 1569, in der Woche der Kreuzverehrung, als der Metropolit an seiner Stelle in der Mariä-Entschlafens-Kathedrale des Kremls stand, betrat der beeindruckende Zar zusammen mit den Gardisten die Kathedrale. Wie es Brauch war, bat er den Metropoliten um einen Segen, aber der Metropolit gab ihm keinen Segen und sagte zu ihm: „Sogar die Tataren und Heiden haben Gesetz und Wahrheit, aber in Russland gibt es kein Mitleid mit den Unschuldigen.“ Diese Worte machten den schrecklichen Herrscher wütend und er ordnete den Beginn der Strafverfolgung des Heiligen an. Im Herbst 1569, während der Heilige die Göttliche Liturgie feierte, stürmten Gardisten in die Mariä-Entschlafens-Kathedrale. Der Schuldspruch wurde verlesen. Die Gewänder des Metropoliten wurden abgerissen und er wurde auf einem Baumstamm aus dem Kreml getragen. Der Heilige wurde im Twerskaja-Otroch-Kloster eingesperrt und die Familie Kolychev wurde gefoltert und hingerichtet. Im Dezember erwürgte Maljuta Skuratow auf persönlichen Befehl Grosnys den heiligen Philipp. Anschließend wurde der Metropolit heiliggesprochen und seine Reliquien in der Mariä-Entschlafens-Kathedrale des Kremls beigesetzt. Der schreckliche Zar wurde auf dem russischen Thron durch Fjodor Ioannowitsch ersetzt, der sich durch schlechte Gesundheit, Sanftmut und Frömmigkeit auszeichnete. Während seiner Herrschaft ereignete sich für die russische Kirche ein historisches Ereignis – die Gründung des Patriarchats. Der heilige Hiob wurde der erste Moskauer Patriarch. Im Jahr 1590 genehmigte der Kirchenrat in Konstantinopel das russische Patriarchat und wies dem Patriarchen von Moskau den fünften Platz in den Diptychen nach Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem zu. Während des Patriarchats von St. Hiob wurde die herrschende Rurik-Dynastie abgebrochen: Zarewitsch Dimitri wurde in Uglitsch getötet, und einige Jahre später starb Zar Fjodor Ioannowitsch. Der Thron ging an den Bojaren Boris Godunow über, doch 1605 wurde er von einem Betrüger erobert, der sich als der auf wundersame Weise entkommene Zarewitsch Dimitri ausgab. Die beginnenden Unruhen dauerten mehrere Jahre, und 1609 marschierten die Truppen des polnischen Königs Sigismund III. in Russland ein. Der Widerstand gegen die Polen wurde vom Patriarchen Hermogenes von Moskau und ganz Russland angeführt. Im Jahr 1611 segnete er die Gründung der Volksmiliz. Dafür wurde er von den Polen im Chudov-Kloster eingesperrt, aber auch aus der Gefangenschaft heraus sandte er weiterhin Botschaften aus, in denen er das Volk aufrief, sich zu vereinen und die heilige Orthodoxie zu verteidigen. Im Februar 1612 starb der Patriarch verhungert im Gefängnis. Und im Oktober befreite die Volksmiliz unter der Führung von Minin und Poscharski Moskau. Die Polen wurden aus dem Kreml vertrieben, wo die Miliz unter Glockengeläut mit Bannern und Bannern eintrat. Im Jahr 1613 wurde Michail Fedorovich Romanov auf den Thron gewählt und der Vater des Zaren, Bojar Fedor Romanov, wurde Metropolit von Moskau und „ernannter Patriarch“. Unter Boris Godunow wurde er zwangsweise zum Mönch mit dem Namen Filaret geweiht. Der Vater und spirituelle Mentor des Königs beteiligte sich aktiv an der Regierung. Er schuf seinen eigenen Hof nach dem Vorbild des königlichen Hofes und erhielt die direkte Kontrolle über die Patriarchalregion, die mehr als 40 Städte umfasste. Filaret wurde der „große Herrscher“ genannt und unter ihm entwickelte sich das Patriarchat zu einem mächtigen Machtzentrum, das im Wesentlichen parallel zum königlichen war. Damit waren der Konflikt zwischen Zar und Patriarch in der Mitte des 17. Jahrhunderts und die Abschaffung des Patriarchats zu Beginn des 18. Jahrhunderts weitgehend vorbestimmt. Auf Initiative des zweiten Zaren aus der Romanow-Dynastie, Alexei Michailowitsch, wurde der junge und energische Metropolit Nikon von Nowgorod auf den patriarchalischen Thron erhoben. Mehr als zehn Jahre lang verband zwischen dem Zaren und dem Patriarchen eine herzliche Freundschaft. Im Jahr 1658 geriet Nikon jedoch in Ungnade, und Alexej Michailowitsch kam nicht mehr zu seinen Gottesdiensten. Anstatt zu versuchen, die Beziehungen zu verbessern, verließ Nikon willkürlich und demonstrativ das Patriarchat und zog sich in das Kloster Neu-Jerusalem zurück. Der Rat von 1660 beschloss, einen neuen Patriarchen zu wählen. Nikon hat diese Entscheidung nicht anerkannt. Anschließend äußerte Nikon sogar, dass dieser Rat nicht nur als Heer der Juden, sondern auch als dämonischer Rat bezeichnet werden sollte, da er angeblich nicht nach den Regeln einberufen wurde: Sie taten, was der König wollte. Metropolit Macarius. Geschichte der russischen Kirche. Schließlich wurde 1666 in Moskau ein Konzil unter Beteiligung der Patriarchen Paisius von Alexandria und Macarius von Antiochia einberufen. Nikon beantwortete die ihm gestellten Fragen ausweichend, indem er die Rechte der östlichen Patriarchen bestritt und die griechischen Kirchenkanone als ketzerisch bezeichnete. Nach vielen Tagen und schmerzhaften Debatten wurde Nikon abgesetzt, seines Priestertums beraubt und zur Buße in ein Kloster geschickt. Der Name des Patriarchen Nikon ist mit einer der tragischsten Seiten in der Geschichte der russischen Kirche verbunden – der Entstehung einer Spaltung. Als Patriarch führte Nikon das von seinen Vorgängern begonnene „Buchrecht“ fort. Bei der Korrektur liturgischer Texte und kirchlicher Bräuche ging er jedoch noch viel weiter. Das für Russland traditionelle Zwei-Finger-Zeichen – das Kreuzzeichen mit zwei gefalteten Fingern – wurde durch ein Drei-Finger-Zeichen ersetzt, entsprechend der damals weit verbreiteten griechischen Praxis. Die im Volk beliebten Erzpriester John und Avvakum lehnten die Nikon-Reform ab. Sie führten die Bewegung an, die später als „Altgläubige“ bekannt wurde. Die Kirchenspaltung hörte auch nach Nikons Ausscheiden aus dem Patriarchat und nach seiner Absetzung nicht auf, da der Große Moskauer Rat von 1667 die von Nikon durchgeführte Reform genehmigte. Das Solovetsky-Kloster wurde für einige Zeit zu einer der Hochburgen der Altgläubigen. Bereits 1658 organisierte sein Abt, Archimandrit Elijah, im Kloster eine Kathedrale, die die neu gedruckten Bücher ablehnte. Im Jahr 1667 schickte Alexei Michailowitsch Truppen nach Solovki, um den Aufstand zu beruhigen. Die Belagerung des Klosters dauerte acht Jahre und ging als „Solovetsky Standing“ in die Geschichte der Altgläubigen ein. Während der Belagerung starben die meisten Mönche an Hunger und Krankheiten, der Rest wurde ausgerottet. Bald nach dem Sieg über die Schismatiker starb Zar Alexei Michailowitsch, und die Altgläubigen betrachteten dies als Strafe Gottes. Von diesem Zeitpunkt an standen die Altgläubigen in Opposition zur Regierung, die sie schweren Verfolgungen aussetzte. Erzpriester Avvakum wurde 1681 zusammen mit anderen Anführern des Widerstands gegen den „Nikonianismus“ in einem riesigen Blockhaus lebendig verbrannt. Die Altgläubigen reagierten auf diese Hinrichtung mit Massenselbstverbrennungen. Im 18.-19. Jahrhundert verbreiteten sich die Altgläubigen in ganz Russland und über seine Grenzen hinaus. Die Altgläubigen haben sich in viele Sekten gespalten, von denen die wichtigsten Priester und Nichtpriester sind. Erstere haben eine Hierarchie und ein Priestertum, letztere nicht. Im Jahr 1971 schaffte der Lokalrat der Russisch-Orthodoxen Kirche die Eide für die alten Riten ab und betonte, dass „der rettenden Bedeutung der Riten nicht die Vielfalt ihres äußeren Ausdrucks entgegensteht“. Die traurige Spaltung hält jedoch bis heute an.
Geschichte
In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts konvertierten mehrere orthodoxe Gemeinden in Polen zum Katholizismus. Gleichzeitig nutzte der lateinische Bischof von Siedlce, Henryk Przezdziecki, die günstige Situation, um die Orthodoxen zum Katholizismus zu konvertieren, und ergriff wiederholt die Initiative, eine neue Union der Orthodoxen mit dem Heiligen Stuhl zu schaffen. Mit der Unterstützung des päpstlichen Nuntius Achille Rati (dem späteren Pius XI.) wurden 1927 in Polen 14 Pfarreien gegründet, die von Jesuiten im byzantinischen Ritus geleitet wurden.
Im Jahr 1931 ernannte der Heilige Stuhl den ukrainischen Bischof Nicholas Czarnecki zum Ordinarius für die Gläubigen des byzantinischen Ritus, die die kirchenslawische Sprache verwenden und in Polen leben. Im selben Jahr gründete der lateinische Bischof von Luzk, Adolf Schelenzhek, in Luzk ein spezielles Seminar für zukünftige Priester der neuen Union. Vor Beginn des Weltkriegs bildete dieses Seminar etwa zwanzig Priester aus. Im Jahr 1937 zählte die neouniate Kirche 71 Geistliche. Zu dieser Zeit waren in der Kirche die Erzdiözesen Wilna, Pinsk, Siedlce, Luzk und Lublin tätig.
Während des Zweiten Weltkriegs stellten die meisten neuunierten Gemeinden ihre Aktivitäten ein und die Mehrheit der Gläubigen kehrte zur Orthodoxie zurück. Im Jahr 1947 hatte die neo-unierte Kirche vier Pfarreien, von denen drei aufgrund der Zwangsumsiedlung der ukrainischen Bevölkerung in die westlichen Teile Polens nicht mehr existierten. Bis in die 80er Jahre existierte die einzige neouniate Pfarrei des Hl. Märtyrers Nikita im Dorf Kostomloty in der Woiwodschaft Niederschlesien.
Aus der polnisch-orthodoxen Kirche.
Im Jahr 1985 wurde in der Kirche St. Nikita der Märtyrerin in Kostomloty ein Kloster der Kleinen Schwestern Jesu gegründet. Im Jahr 1998 wurde am selben Ort ein Männerkloster der Marienväter gegründet.
Im Jahr 2007 gab es in Polen 11 Pfarreien der Neuuniatenkirche, die der Jurisdiktion des lateinischen Bischofs von Siedlce unterstehen.
Literatur
- Roman Skakun. „Neue Union“ in der anderen Republik Polen (1924-1939) // Ark. Wissenschaftliche Sammlung zur Kirchengeschichte / hrsg. Ö. Boris Gudzyak, Igor Skochilyas, Oleg Turiya. - V. 5. - Lemberg: Verlag "Missioner" 2007. - S. 204-247.
- Stokolos N. G. Neounia als Experiment einer ähnlichen Politik wie der Vatikan in Polen (1923-1939). // „Ukrainisches Geschichtsjournal“. 1999 – Teil 4 (427). - S. 74-89.
- Florentyna Rzemieniuk, „Kościół Katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounia)“, Lublin 1999.
- Jan Szczepaniak, „Polskie władze państwowe wobec akcji neounijnej w latach 1918-1939“, „Charisteria Titi Górski oblata. Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskiemu“, Krakau, s. 241-254.
- Zofia Waszkiewicz, „Neounia – nieudany eksperyment?“, „400-lecie zwarcia Unii Brzeskiej (1596-1996). Das Material ist für die nächsten Tage unbrauchbar. 28-29. 11. 1996“, pod rot. S. Alexandrowicza und T. Kempy, Toruń 1998, s. 115-146.
- Bożena Łomacz, „Neounia“, „Więź“ nr 1 (291) ze stycznia 1983 r., s. 82-90.
- Mirosława Papierzyńska-Turek, „Akcja neounijna i kontrowersje wokół rozumienia polskiej racji stanu“, Ta że, „Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918-1939“, Warszawa 1989, s. 404-441.
- H. Wyczawski, „Ruch neounijny w Polsce w latach 1923-1939“, „Studia Theologica Warsoviensis“ 1970/8, s. 409-420.
Auf der Website des Informationsdienstes gehen viele Fragen zum Beitritt zur katholischen Kirche ein, insbesondere zur Frage der Beibehaltung oder Änderung des Ritus in diesem Fall. Zur Klärung wandten wir uns an den Generalvikar der Erzdiözese der Muttergottes in Moskau, Monsignore Sergei Timashov.
Boris fragt: „Hallo! Ich habe so etwas gelernt, dass man angeblich bei der Konvertierung von der Orthodoxie zum Katholizismus nach Katechesekursen einen Brief an den Vatikan schicken muss, um die Erlaubnis zu erhalten, Katholik des lateinischen Ritus zu werden, aber warum sagen die Äbte dann nichts dazu? ?“
In dieser Angelegenheit gibt es mehrere Punkte, die einer Klärung bedürfen. Erstens ist es falsch, von „Übergang“ zu sprechen, als ob wir von einem Umzug von einer Pfarrei in eine andere reden würden. Die katholische Kirche, die von der Wahrheit und Gültigkeit der Sakramente in den Ostkirchen überzeugt ist, stellt die christliche Tradition, die diese Kirchen bewahren, nicht in Frage (dies wird insbesondere durch die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils deutlich belegt). Andererseits ist die katholische Kirche davon überzeugt, dass ihr die Fülle der Wahrheit anvertraut wurde, und kann daher nicht umhin, unter ihren Mitgliedern Menschen aufzunehmen, die außerhalb der katholischen Kirche gültig getauft sind und in die Gemeinschaft mit der versammelten Kirche eintreten möchten um den Bischof von Rom herum, in dem, wie das Zweite Vatikanische Konzil lehrt, die Fülle der Kirche Christi ihren Sitz hat.
Zweitens ist der Wunsch derjenigen, die in die volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche eintreten, dies gerade im lateinischen Ritus zu tun, zumindest für die Kirche selbst keineswegs selbstverständlich. Gemäß Kanon 35 des Codex der Kanones der Ostkirchen müssen „getaufte Nichtkatholiken, die in die volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche eintreten, ihren Ritus auf der ganzen Welt beibehalten und praktizieren und ihn befolgen, soweit es in ihrer Macht steht.“ Sie müssen also in die Kirche aufgenommen werden sui iuris denselben Ritus, und das Recht von Einzelpersonen, Gemeinschaften oder Regionen, sich in besonderen Fällen an den Heiligen Stuhl zu wenden, bleibt gewahrt.
Wie wir sehen, empfiehlt die Kirche nachdrücklich, dass orientalische Christen, die ihr beitreten, in ihrem eigenen, d.
Warum besteht die Kirche so sehr auf der Beibehaltung des Rituals?
Da es sich um getaufte Menschen handelt, kann die Kirche die Tatsache nicht ignorieren, dass sie bereits einer bestimmten Tradition angehören, die sie oder ihre Eltern oder Verwandten auf die Idee der Taufe gebracht hat. Der Beginn des christlichen Lebens ist gerade die Taufe und nicht der Moment der mehr oder weniger bewussten Kenntnis des Katechismus. Die Tatsache, dass eine Person in einer christlichen Kirche oder Kirchengemeinschaft getauft wird, bedeutet also, dass sie aufgrund ihrer persönlichen Geschichte bereits in eine Art Erbe aufgenommen ist, das als Ritus bezeichnet wird. Die katholische Kirche erkennt die Existenz von Riten an, die zu den sechs Traditionen gehören, und bekräftigt die gleiche Würde der Kirchen, die Ausdruck dieser Riten sind.
Es muss zugegeben werden, dass es historisch gesehen in vielen Fällen eine Vorstellung von einer gewissen Überlegenheit und Vollkommenheit des lateinischen Ritus im Vergleich zu anderen gab, die sehr oft unbewusst (manchmal jedoch auch bewusst) zu dem Wunsch führte, Christen davon zu überzeugen, im Bewusstsein der Notwendigkeit der katholischen Einheit, den Glauben im lateinischen Ritus zu praktizieren. Es waren diese Missverständnisse, die die Päpste im 19. Jahrhundert nach und nach zu der Notwendigkeit führten, die gleiche Würde aller Riten zu bekräftigen und zu verteidigen und dem lateinischen Klerus sogar zu verbieten, unerfahrene Christen, die mit der wahren kirchlichen Lehre nicht ausreichend vertraut waren, in ihre Kirche zu locken Ritus. Die gleiche Würde der Riten ist die feste und klare Lehre der katholischen Kirche, und diese Lehre brauchte, da sie von Vorurteilen getrübt war, einen solchen disziplinarischen und kanonischen Schutz.
Geleitet von dem Wunsch, die Gleichheit der Riten zu wahren und den Lebensweg im katholischen Glauben so einfach wie möglich zu gestalten, Die Kirche überlässt die Frage der Zugehörigkeit zu einem Ritual nicht der freien Wahl eines Christen. Das Ritual wird im Moment der Taufe festgelegt. Die Entscheidung liegt entweder bei den Eltern, die das Kind taufen wollen, oder beim Erwachsenen selbst, der sich taufen lassen möchte.
Gleichzeitig ist es wichtig zu verstehen, dass aus Sicht der Kirchendisziplin die Zugehörigkeit zum Ritus durch die Zugehörigkeit zu einem bestimmten kulturellen und spirituellen Erbe bestimmt wird und nicht durch die Zugehörigkeit zum Taufspender. Lassen Sie mich noch einmal betonen: Der Ritus wird durch die Herkunft der getauften Person bestimmt und nicht dadurch, welcher Tempel und welcher Pfarrer die Taufe vollzogen hat. Wenn beispielsweise katholische Eltern ihr Kind in Ermangelung einer katholischen Kirchengemeinde zur Taufe in eine orthodoxe Kirche bringen, ist es dadurch nicht Mitglied der russisch-orthodoxen Kirche.
Allerdings kann die Tatsache einer realen Begegnung mit Christus in einer Kirche, die einen anderen Ritus als den Taufritus praktiziert (z. B. im lateinischen Ritus für orthodoxe Christen), ein ernstes Motiv für den Wechsel in die Kirche des lateinischen Ritus darstellen . Es ist jedoch nicht der Christ selbst und auch nicht der Abt, mit dem er verbunden ist, sondern nur der Apostolische Stuhl, der feststellen kann, ob dieses Motiv nach kanonischem Recht einen legitimen Grund für die Änderung des Ritus darstellt.
„Was ist mit denen, die beigetreten sind, bevor die Erlaubnis zur Änderung des Rituals erforderlich war“, fragt Andrey. „Wie ist ihr Status?“
Der Kanoneskodex der Ostkirchen ist seit 1990 in Kraft. Folglich hat zumindest ab diesem Zeitpunkt kein impliziter Wunsch, der katholischen Kirche speziell im lateinischen Ritus beizutreten, sofern er nicht in einer entsprechenden schriftlichen Petition an den Apostolischen Stuhl geäußert wurde, keine rechtlichen Konsequenzen. Alle Christen, die in der orthodoxen Kirche getauft und anschließend in die volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche aufgenommen wurden, sind Katholiken des byzantinischen Ritus, es sei denn, sie haben beim Apostolischen Stuhl die Erlaubnis zur Änderung des Ritus beantragt und erhalten.
Es muss zugegeben werden, dass die Geistlichen und Katecheten lateinischer Pfarreien lange Zeit, wenn sie mit Anträgen auf Aufnahme in die katholische Kirche konfrontiert wurden, diesen Bestimmungen der Kirchendisziplin ihre Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit derjenigen, die dazu kamen, nicht schenkten.
Frage: „Was ist der „Ritus“ des Beitritts (wenn eine Person bereits in der orthodoxen Kirche getauft wurde), diesem „8. Sakrament“?“
Natürlich sprechen wir nicht von einem Sakrament. Ein Katholik ist jeder, der entweder in die katholische Kirche getauft wurde oder ihr durch einen formellen Akt beigetreten ist. Der Beitrittsakt ist unwiderruflich und unwiderruflich, daher besteht die Kirche darauf, dass alles getan wird, um sicherzustellen, dass diese Entscheidung bewusst getroffen wird. Hierfür ist der Pfarrer verantwortlich, der darüber entscheidet, welche Vorbereitungsformen hierfür notwendig sind.
Ivans Frage: „Ist die Katechese beim Übergang von der orthodoxen zur katholischen Kirche (Beitritt) obligatorisch“?
Da es sich bei der Katechese um die Weitergabe des Glaubens zur Vorbereitung auf die Taufe handelt, kann hier nicht von Katechese im eigentlichen Sinne des Wortes gesprochen werden. Andererseits ist es offensichtlich, dass die Entscheidung, in die volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche einzutreten, bewusst sein muss – nicht nur für denjenigen, der darum bittet, sondern auch für die Kirche selbst. Der Kirchengemeinschaft muss klar sein, dass der Christ, der um die volle Kommunion bittet, versteht, was die Kirche ist, und dass dies keine vorübergehende Entscheidung seinerseits ist. Kommunikation genau bereitgestellt, hinein akzeptieren, und das bedeutet, dass nur der Wunsch nicht ausreicht, sondern auch das aktive Handeln der anderen Seite notwendig ist. Was in diesem Fall üblicherweise als „Katechese“ bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit eine Zeit des Kennenlernens der Lehren der katholischen Kirche, des Kennenlernens der katholischen Gemeinschaft als solcher, sodass eine Person klar erkennen kann, wohin sie geht. Dieser gesamte Zeitraum zielt darauf ab, mehr Freiheit bei der Entscheidungsfindung über den Beitritt zu gewährleisten.
Da die volle Kommunion offensichtlich die Annahme der Sakramente voraussetzt, muss die Kirche ihrerseits dafür sorgen, dass der Mensch zu dieser Annahme der Sakramente bereit ist, dass er ein richtiges Verständnis seiner Kirchenzugehörigkeit, ein Verständnis von Beichte und Kommunion hat . Traditionell beträgt diese Zeit mehrere Monate. Insbesondere legt die Kirche großen Wert auf die ordnungsgemäße Feier des Tages der Auferstehung des Herrn, vor allem durch die Teilnahme an der Sonntagsliturgie.
Eine weitere Frage von Ivan hängt damit zusammen: „Wenn jemand keine Katechese absolvieren möchte (aus Zeitmangel, wenn er bereits über Glauben und Wissen verfügt), kann er angeschlossen werden oder ist er „verpflichtet“, einen Kurs zu belegen? das ist für ihn unnötig?
Der einzige Grund für den sofortigen Beitritt zur katholischen Kirche ist die unmittelbare Todesgefahr. Jeder katholische Priester kann dies tun. In allen anderen Fällen besteht kein Grund zu besonderer Eile.
Es ist wichtig zu verstehen, dass man nur darum bitten kann, der Kirche beizutreten, es aber nicht verlangt werden kann. Der Versuch, etwas von der Kirche zu fordern, ist ein Beweis für ein unzureichend klares Verständnis ihres Wesens und bedeutet nicht, dass eine Person einen katholischen Glauben hat.
Frage: „Bedeutet das, dass Katholiken, die von ihrer Zugehörigkeit zum byzantinischen Ritus erfahren haben, es jetzt sind? muss Sollten wir die Sakramente speziell in Pfarreien des byzantinischen Ritus beginnen?“
Passendes Wort: aufgerufen. Kanon 40 des Codex der Kanones der Orientalischen Kirchen bringt den festen Wunsch der Kirche zum Ausdruck, dass die Gläubigen danach streben, ihren Ritus besser kennenzulernen und zu lieben. Gleichzeitig setzt die Kirche mit ihrem Beharren auf der Zugehörigkeit zum aus der Taufe hervorgehenden Ritus die Möglichkeit für jeden einzelnen Christen voraus, in die katholische Kirche jeglichen Ritus zu kommen und die Sakramente zu empfangen.
Informationsdienst der Erzdiözese der Muttergottes in Moskau