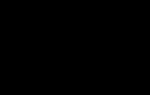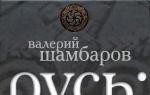Methoden zur Untersuchung des Proteinstoffwechsels – praktische Fähigkeiten eines Kinderarztes. Untersuchung des Leberproteinstoffwechsels Die Hauptursachen für Proteinurie sind
Seite 66 von 76
Video: Bestimmung von reaktivem Protein im Blutserum
Indikatoren für das gesamte Blutplasmaprotein und seine einzelnen Fraktionen sind für die Diagnose vieler Krankheiten wichtig.
Bestimmung des gesamten Serumproteins. Es kann mit verschiedenen Methoden hergestellt werden (nitrometrische, gravimetrische, nephelometrische, refraktometrische, spektrophotometrische usw.). Von den kolorimetrischen Methoden ist die Biuret-Methode die spezifischste, empfindlichste, genaueste und praktisch zugänglichste. Diese Methode wird als einheitliche Methode zur Bestimmung des Gesamtproteins im Blutserum vorgestellt. Es basiert auf folgendem Prinzip: Proteine reagieren im alkalischen Milieu mit Kupfersulfat und bilden violett gefärbte Verbindungen.
Die Technik zur Bestimmung des Gesamtproteins ist wie folgt. Zu 5 ml einer Arbeitslösung des Biuret-Reagens (4,5 g Rochelle-Salz werden in 40 ml 0,2 N NaOH gelöst, 1,5 g C11SO4 · 5H2O und 0,5 g K1 hinzufügen und zu 100 ml 0,2 N NaOH hinzufügen) 0,1 ml hinzufügen von Blutserum. Nach 30 Minuten wird die Probe auf FEC in einer 10-mm-Küvette mit grünem Filter gegen die Kontrolle kolorimetrisch kalibriert. Um die Kontrolle vorzubereiten, fügen Sie 0,1 ml 0,9 % NaCl zu 5 ml Biuret-Reagenz hinzu. Die Berechnung erfolgt gemäß Kalibrierplan.
Die normale Gesamtproteinkonzentration bei Erwachsenen liegt zwischen 62 und 82 g/L. Die Daten nach Alter für Kinder sind in der Tabelle aufgeführt. 49.
Tab.g. 49. Gehalt an Proteinfraktionen als Prozentsatz der Gesamtproteinmenge (Durchschnittsdaten) nach Alter (nach Yu. E. Veltishchev, 1979)
Die häufigsten Gründe für die Entwicklung einer Hypoproteinämie sind eine unzureichende Aufnahme von Proteinen aus der Nahrung in den Körper (Proteinmangel), erhebliche Proteinverluste und eine Hemmung der Biosyntheseprozesse von Blutproteinen.
Eine unzureichende Aufnahme von Proteinen in den Körper wird bei Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts (Verengung der Speiseröhre, Pylorospasmus und Pylorusstenose, Tumoren, entzündlichen Prozessen des Magen-Darm-Trakts usw.), niedrigem Proteingehalt in der Nahrung oder unausgewogener Aminosäure beobachtet Säurezusammensetzung usw.
Nierenerkrankungen, die mit Proteinurie, akuten und chronischen Blutungen, ausgedehnten Exsudaten und Ergüssen in seröse Hohlräume, Verbrennungen usw. einhergehen, führen zu einem Proteinverlust des Körpers.
Hypoproteinämie, verbunden mit einer Abnahme der Proteinbiosynthese in der Leber, tritt bei chronischer Hepatitis, Vergiftung, Leberzirrhose, längeren eitrigen Prozessen, bösartigen Tumoren usw. auf.
Hyperproteinämie ist ein relativ seltenes Phänomen. Beobachtet bei Exikose, Diabetes insipidus, Darmverschluss, generalisierter Peritonitis, Myelom (anhaltend bis 120 g/l).
Methoden zur Bestimmung von Proteinfraktionen im Blutserum. Die Untersuchung quantitativer Beziehungen zwischen einzelnen Proteinfraktionen hat einen wichtigen diagnostischen Wert, da sie die Unterscheidung bestimmter Arten von Hypo- und Hyperproteinämie sowie einer Reihe von Krankheiten ermöglicht, die nicht mit Veränderungen des Gesamtproteingehalts einhergehen.
Zur Fraktionierung von Plasmaproteinen werden Aussalzen mit Neutralsalzen, elektrophoretische Fraktionierung, immunologische und Sedimentationsmethoden, Fällung mit Ethylalkohol bei niedriger Temperatur, Chromatographie und Gelfiltration eingesetzt. Die am häufigsten verwendeten Methoden sind elektrophoretische Methoden, die auf unterschiedlichen Bewegungsgeschwindigkeiten von Proteinen in einem elektrischen Feld basieren, abhängig von ihrer elektrischen Ladung und anderen physikalischen und chemischen Eigenschaften.
Weit verbreitet sind Methoden der Elektrophorese auf Papier und Gelen – Agar, Stärke und andere, insbesondere auf Polyacrylamidgel, mit denen etwa 30 Proteinfraktionen gewonnen werden können. Die Elektrophorese auf Celluloseacetatfilmen wurde immer häufiger eingesetzt. In klinischen Diagnoselabors wird jedoch überwiegend die Methode der Elektrophorese auf Papier verwendet (V. G. Kolb, V. S. Kamyshnikov, 1976). Diese Methode basiert auf folgendem Prinzip: Unter dem Einfluss eines konstanten elektrischen Feldes bewegen sich Serumproteine, die eine elektrische Ladung haben, mit einer Geschwindigkeit, die von der Größe der Ladung und dem Molekulargewicht abhängt, entlang eines mit einer Pufferlösung befeuchteten Papiers. Serumproteine werden in fünf Fraktionen unterteilt: Albumin und Globuline a1, a2, b, y.
Das normale Verhältnis von Albumin zu Globulin (Albumin-Globulin-Verhältnis) beträgt etwa 2:1. Der Anteil der einzelnen Proteinfraktionen bei Erwachsenen und Kindern je nach Alter ist in der Tabelle dargestellt. 49. Die Gesamtmenge an Proteinen und Proteinfraktionen im Blut verändert sich bei verschiedenen Krankheiten bei Kindern.
Bei Erwachsenen und älteren Kindern werden folgende Arten von Elektropherogrammen unterschieden: I) akuter Entzündungsprozess – 2) subakute chronische Entzündung – 3) nephrotischer Symptomkomplex – 4) bösartige Neubildungen – 5) Hepatitis – 6) Leberzirrhose – 7) obstruktiver Ikterus - 8) - und p-Globulin-Plasmozytome.
Beim ersten Typ kommt es zu einer Abnahme des Albuminspiegels und einem Anstieg der a1-, a2-Globuline und in späteren Stadien auch der γ-Globuline; beim zweiten kommt es zu einer moderaten Abnahme der Albuminfraktionen und einem deutlichen Anstieg der a2- , γ-Globulinfraktionen; im dritten eine signifikante Abnahme der Albumine, ein Anstieg der a-Globuline mit einer moderaten Abnahme der γ-Globuline; im vierten eine Abnahme der Albumine und ein signifikanter Anstieg aller Globulinfraktionen; im fünftens - eine mäßige Abnahme der Albumine und ein Anstieg der γ- und (3-Globuline); im sechsten - eine Abnahme der Albumine mit einem starken Anstieg der γ-Globulinfraktion, deren Basis erweitert ist - im siebten - a Abnahme des Albumins und mäßiger Anstieg der CC2-, P- und γ-Globuline; im achten - Gesamtprotein ist stark erhöht, Albumine und die meisten Globuline sind reduziert, je nach Typ sind γ- oder γ-Globuline stärker erhöht - Bowlinen.
Bei Säuglingen besteht ein physiologischer Mangel in der Biosynthese von γ-Globulinen. Daher steigen ihre B- und A2-Globuline bei Infektionskrankheiten stärker an als bei älteren Kindern und Erwachsenen. Ein konstanter Anstieg der γ-Globuline bei kleinen Kindern kann auf eine septische Erkrankung hinweisen.
Die Rolle der Leber im Proteinstoffwechsel ist sehr groß: Proteine werden in ihr synthetisiert und abgelagert, Aminosäuren, Nahrungspolypeptide und Abbauprodukte von Gewebeproteinen gelangen mit dem Blut in sie.
Hier erfolgt deren Abbau, Neutralisierung und Entfernung ungenutzter Abbauprodukte. Einige Aminosäuren unterliegen einer Desaminierung und Transaminierung. Das freigesetzte Ammoniak wird von der Leber in weniger giftigen Harnstoff umgewandelt. Aus Aminosäuren, die sowohl von außen zugeführt als auch von der Leber synthetisiert werden, baut es wieder die Proteine seines eigenen Gewebes sowie Blutproteine auf; Albumin, Globuline (a und p und teilweise y), Fibrinogen, Prothrombin, Heparin, einige Enzyme. In der Leber werden Verbindungen von Proteinen mit Lipiden (Lipoproteinen) und Kohlenhydraten (Glykoproteinen) gebildet.
Eine Verletzung der proteinbildenden Funktion der Leber wird durch die Untersuchung von Proteinen im Blutplasma oder Serum festgestellt. Diese Störung betrifft weniger die Gesamtmenge der Proteine als vielmehr das Verhältnis ihrer Fraktionen, eine Veränderung, die – Dysproteinämie – bei den meisten Leberläsionen beobachtet wird.
Methode der Papierelektrophorese Die derzeit in der klinischen Praxis am weitesten verbreitete Methode basiert auf der Tatsache, dass sich in einem elektrischen Feld verschiedene Proteine, je nach Größe, Form des Moleküls, seiner Ladung und anderen Faktoren, mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in Richtung der positiven Elektrode bewegen. Bei der Elektrophorese auf Papier werden unterschiedliche Proteinfraktionen an verschiedenen Stellen des Papierstreifens konzentriert, wo sie durch entsprechende Färbung identifiziert werden können. Die Größe der Fraktionen wird durch die jeweilige Farbintensität bestimmt. Blutplasmaproteine werden in fünf Hauptfraktionen unterteilt: Albumin; w-, a2-, p- und y-Globuline. Die Elektrophorese in anderen Medien (Agar, Stärkegel usw.) ermöglicht die Auftrennung von Proteinen in eine größere Anzahl von Fraktionen.
Bei Lebererkrankungen ist eine Abnahme des Albumin-Globulin-Verhältnisses (A/G) am häufigsten, hauptsächlich aufgrund einer Abnahme des Albumingehalts (beeinträchtigte Albuminsynthese). Bei einer akuten Leberentzündung (akute Hepatitis) wird ein Anstieg des Gehalts an α2-Globulinen im Blutplasma beobachtet, bei chronischen Entzündungen hauptsächlich γ-Globuline, möglicherweise aufgrund der Ansammlung von Antikörpern, die sich während der Elektrophorese mit γ-Globulinen bewegen; Gleichzeitig erhöht sich oft auch die Gesamtmenge an Molkenprotein. Bei einer Leberzirrhose sinkt der Gesamtproteingehalt im Serum deutlich, hauptsächlich aufgrund von Albumin; allerdings steigt der Gehalt an γ-Globulinen merklich an.
Fibrinogen Während der Elektrophorese auf Papier wandert es mit γ-Globulinen und wird nicht separat nachgewiesen. Zur quantitativen Bestimmung wird Fibrinogen durch Zugabe von Calciumchlorid aus dem Plasma ausgefällt und anschließend das gewaschene und getrocknete Sediment gewogen oder das Protein in diesem Sediment nach seiner Auflösung bestimmt. Fibrinogen wird in der Leber synthetisiert, daher nimmt bei schweren Leberschäden die Menge an Fibrinogen im Plasma ab, was auch die Blutgerinnung beeinträchtigen kann. Sein normaler Gehalt beträgt 2–4 g/l oder 8–14 mg/ml (200–400 mg % – Gerinnungsgewicht; Rutberg-Methode).
Gesamtplasmaprotein am häufigsten durch die refraktometrische Methode bestimmt, und in Abwesenheit eines Refraktometers - durch chemische Methoden: Kjeldahl, Biuret-Reaktion, sowie nephelometrische usw.
Proteinsedimentproben. Das Verhältnis der Proteinfraktionen wird zusätzlich zur Elektrophorese durch Immunelektrophorese, Ultrazentrifugation usw. bestimmt. Zusätzlich zur direkten Bestimmung des Verhältnisses der Proteinfraktionen werden eine Reihe einfacher Tests verwendet, um das Vorliegen einer Dysproteinämie festzustellen. Dabei handelt es sich um sogenannte Proteinsedimentproben (Flockungsproben). Ihr Kern besteht darin, dass bei Dysproteinämie, insbesondere bei einer Abnahme des Albumingehalts, die Stabilität des kolloidalen Blutsystems gestört ist. Diese Störung wird erkannt, wenn dem Serum ein Elektrolyt in einer Konzentration zugesetzt wird, die das normale Serum nicht verändert, bei Dysproteinämie jedoch eine Trübung oder Ausflockung – Proteinflockung – verursacht. Das Gleiche wird beobachtet, wenn pathologische Proteine – Paraproteine – im Blut auftreten. Diese Probengruppe umfasst Proben mit Quecksilberchlorid (Takata-Ara-Reaktion, Grinstead- und Gross-Quecksilbertests), Zinksulfat, Cadmiumsulfat, Lugol-Lösung usw. In einer anderen Gruppe von Flockungstests ist das Reagens eine kolloidale Lösung, deren Stabilität gestört wird, wenn ihr eine kleine Menge dis- oder paraproteinämisches Serum zugesetzt wird (Thymol-, Goldkolloidtests usw.).
Thymol-Test basiert auf der Bestimmung des Trübungsgrads des kolloidalen Thymolreagens, wenn 1 bis 1 Volumens Serum hinzugefügt werden. Positiv ist es vor allem dann, wenn der Gehalt an p-Lipoproteinen im Serum steigt. Dies ist einer der konstant positiven Tests für Virushepatitis und diffuse Leberschäden. Es ist negativ für obstruktiven Ikterus.
Mit einem deutlichen Anstieg der Menge an Globulinen und insbesondere Fibrinogen, die Formol-Test - Umwandlung von Molke in eine gelatineartige Masse (Gelatinierung) durch Zugabe von Formaldehyd.
Alle Sedimenttests (Dutzende davon wurden vorgeschlagen) sind unspezifisch, ihre Veränderungen werden nicht nur bei Lebererkrankungen, sondern auch bei Myelomen, Kollagenosen usw. festgestellt. Diese Tests zeigen Dysproteinämie, jedoch auf viel einfachere und zugänglichere Weise als die Elektrophorese.
Prothrombin (Blutgerinnungsfaktor II) wird nur in der Leber unter Beteiligung von Vitamin K synthetisiert. Die Ursache einer Hypoprothrombinämie kann entweder eine Verletzung der Fähigkeit der Hepatozyten zur Synthese von Prothrombin oder ein Mangel an fettlöslichem Vitamin K sein, das in die Leber gelangt aus dem Darm. Bei obstruktiver Gelbsucht, wenn die Aufnahme von Fetten und damit von Vitamin K beeinträchtigt ist, nimmt die Produktion von Prothrombin durch die Leber und sein Gehalt im Blut ab. Um die Ursache einer Hypoprothrombinämie zu bestimmen, verwenden Sie Test mit parenteraler Gabe von Vitamin K . Steigt danach der Serumprothrombingehalt an, bedeutet dies, dass die Prothrombinbildungsfunktion der Leber nicht beeinträchtigt ist. Dieser Test hilft, obstruktiven Ikterus von parenchymalem Ikterus zu unterscheiden. Prothrombin wird durch die Gerinnungsrate von rekalzifiziertem Plasma in Gegenwart von überschüssigem Thromboplastin bestimmt.
Bestimmung des Gehalts an Proteinabbauprodukten. Unter den Proteinabbauprodukten sind Aminosäuren, Harnstoff, Reststickstoff und Ammoniak von einiger diagnostischer Bedeutung. Gesamt Aminosäuren Der Blutspiegel steigt nur bei schwerer Leberschädigung an, wenn die im Allgemeinen recht stabilen Desaminierungs- und Harnstoffbildungsfunktionen gestört sind. Voraussetzung für die Erhöhung des Inhalts Reststickstoff Blutungen bei Lebererkrankungen gehen mit einer gleichzeitigen Beeinträchtigung der Nierenfunktion einher. Der Anstieg des Reststickstoffs bei Nierenversagen unterscheidet sich von dem bei Leber-Nieren-Versagen dadurch, dass im ersten Fall der Reststickstoff hauptsächlich aus Harnstoff besteht und im zweiten Fall ein erheblicher Anteil aus Aminosäuren besteht. Die separate Bestimmung von Blutaminosäuren mittels Chromatographie liefert keine ausreichend klaren diagnostischen Daten für Leberschäden, um ein derart arbeitsintensives Verfahren zu rechtfertigen. Die Methode zur Bestimmung von Leucin- und Tyrosinkristallen im Urinsediment, die bei akuter Leberdystrophie darin auftreten, behält einen gewissen diagnostischen Wert.
Quantitative Bestimmung von Serumproteinen. Veränderungen in der Proteinzusammensetzung des Blutes sind zwar keine völlig spezifische Manifestation einer Leberschädigung, spiegeln jedoch die Art des pathologischen Prozesses (Entzündung, Nekrose, Neoplasie usw.) sowie eine Verletzung der proteinbildenden Funktion wider die Leber und das retikulo-histiozytäre System. Für die quantitative Bestimmung von Serumproteinen gibt es verschiedene physikalisch-chemische Methoden: refraktometrische Methoden, kolorimetrische Methoden (Biuret-Methoden), iephelometrische Methoden und elektrophoretische Fraktionierung. Normalwerte für das Gesamtserumprotein liegen bei Aussalzmethoden bei 7 bis 8 g %, davon 3,5-5,1 g % Albumin und 2,5-3,5 g % Globulin. Das Verhältnis der Albuminmenge zur Globulinmenge (siehe Albumin-Globulin-Verhältnis) beträgt 1,5-2,3. Die elektrophoretische Analyse (siehe Elektrophorese) ergibt normalerweise die folgenden Verhältnisse der einzelnen Proteinfraktionen (in %): Albumin – 55–60; α1-Globuline – 2,1–3,5; α2-Globuline – 7,2–9,1; β-Globuline – 9,1–12,7; U-Globuline – 16-18 Gesamtproteingehalt. Hyperproteinämie wird bei chronischer Hepatitis und postnekrotischer Leberzirrhose beobachtet. Hypoproteinämie – häufiger bei portaler Zirrhose, insbesondere bei Aszites.
Eine Abnahme der Serumalbuminmenge aufgrund einer Verletzung ihrer Synthese in der Leber wird bei schweren Formen der Hepatitis, anhaltendem obstruktiven Ikterus und insbesondere bei Patienten mit Leberzirrhose (in 85 % der Fälle) beobachtet. Ein Anstieg der γ-Globuline wird fast ständig bei Leberzirrhose (häufiger bei postnekrotischer Lebererkrankung), chronischer Hepatitis, Schädigung der extrahepatischen Gallenwege mit Infektion und primärem Leberkrebs beobachtet. Typischerweise ist ein Anstieg des β-Globulin-Anteils mit hohen Serumlipidwerten verbunden; Bei chronischer Hepatitis, Entzündungen der Gallenwege und anhaltendem obstruktiven Ikterus wird ein Anstieg der Menge an α2-Globulinen beobachtet. Ein besonders starker Anstieg des Gehalts an α2-Globulinen weist auf die Möglichkeit bösartiger Lebertumoren hin. Bei schweren Formen der Leberzirrhose ist im Elektropherogramm ein Anstieg und eine Verschmelzung der β- und γ-Globulinfraktionen zu beobachten.
Sedimentproben. Anhand dieser Proben kann man indirekt den Zustand der Proteinzusammensetzung des Blutes und in gewissem Maße auch den Funktionszustand der Leber beurteilen. Die Ergebnisse von Sedimentproben hängen nicht nur vom Verhältnis und der Art der Proteinfraktionen des Blutserums ab, sondern auch vom Vorhandensein von mit Protein assoziierten Nicht-Protein-Substanzen (Lipide, Elektrolyte usw.).
Der Sublimattest basiert auf der Ausfällung von Blutserumproteinen mit einer Sublimatlösung. Die Ergebnisse werden in Millilitern Sublimatlösung ausgedrückt, die bis zur Trübung zugegeben wird (Norm 1,8–2,2 ml). Dieser Test ist bei chronischer Hepatitis und Leberzirrhose häufiger positiv, bei akuter Hepatitis seltener. Auch bei anderen entzündlichen Erkrankungen (Pneumonie, Rippenfellentzündung, akute Nephritis etc.) wird ein positiver Quecksilberchlorid-Test beobachtet.
Der Veltman-Test (siehe Veltman-Gerinnungsband) wird bei akuten entzündlichen Prozessen verkürzt (Linksverschiebung) und bei chronischen Prozessen verlängert (Rechtsverschiebung). Eine Schädigung des Leberparenchyms führt in der Regel zu einer Verlängerung des Gerinnungsbandes.
Der Thymol-Test basiert auf der elektrophotometrischen Bestimmung des Trübungsgrades von Blutserum im Vergleich zu Standardlösungen nach 30 Minuten. nach Zugabe von Thymolreagenz. Indikatoren werden in Lichtabsorptionseinheiten angegeben (Norm 1,5 Einheiten). Dieser Test spiegelt eher eine Entzündungsreaktion als eine direkte hepatozelluläre Schädigung wider. Der Test ist positiv für anikterische Hepatitis, Fettleber und Leberzirrhose. Ein Anstieg des Thymol-Tests am Ende einer akuten Hepatitis kann auf den Übergang in eine chronische Form hinweisen.
Takata-Ara-Test – die Bildung eines Niederschlags aus Molkenproteinen unter Zusatz von Sublimat, Soda und Fuchsin. Unter normalen Bedingungen bildet sich bei bekannten Serumverdünnungen ein Niederschlag. Bei Lebererkrankungen wird es bei größeren Serumverdünnungsgrenzen gebildet.
Die Reaktion ist positiv, wenn sich nach 24 Stunden in mindestens drei aufeinanderfolgenden Reagenzgläsern ein flockiger Niederschlag bildet; sie ist schwach positiv, wenn sich in zwei Reagenzgläsern ein Niederschlag bildet.
Die Reaktion ist positiv bei chronischer Hepatitis, ihrem Übergang zur Leberzirrhose, Leberzirrhose und seltener bei akuter Hepatitis. Diese Reaktion ist auch bei anderen entzündlichen Erkrankungen (Pleuritis, Lungenentzündung, Tuberkulose etc.) positiv.
Die Unspezifität von Sedimentproben mindert ihren Wert als funktionelle Lebertests, sie spiegeln jedoch die Dynamik der Entwicklung des pathologischen Prozesses (Schweregrad, Schweregrad, Komplikationen) wider. Es empfiehlt sich, sie in Kombination mit mehreren Proben und elektrophoretischen Untersuchungen von Proteinfraktionen zu verwenden.
Blutammoniak. Um den Ammoniakspiegel im Blut zu bestimmen, wird am häufigsten die isometrische Destillationsmethode nach Conway verwendet. Normalerweise ist der Ammoniakgehalt im venösen Blut extrem niedrig oder gleich Null. Der Ammoniakspiegel steigt, wenn Kollateralen im Pfortadersystem vorhanden sind, die Blut mit einem hohen Ammoniakgehalt aus dem Darm direkt in das Venennetz transportieren. Während des Leberkomas wird ein deutlicher Anstieg des Ammoniakspiegels im Blut beobachtet.
Blutglykoproteine sind hochmolekulare Komplexe aus Proteinen und Mucopolysacchariden. Glykoproteine können mittels Papierelektrophorese bestimmt werden. Im Blut kommen Glykoproteine in allen Proteinfraktionen vor. Ihr durchschnittlicher Albumingehalt beträgt 20,8 %; in α1-Globulinen - 18,6 %; in α2-Globulinen - 24,8 %; in β-Globulinen - 22,3 %; in U-Globulinen - 13,7 %. Darüber hinaus kann eine einfachere Diphenylaminreaktion eingesetzt werden (dem proteinfreien Blutserumfiltrat wird ein Diphenylaminreagenz zugesetzt).
Bei Morbus Botkin und chronischen Lebererkrankungen ist in Phasen der Exazerbation der Gehalt an α-Glykoproteinen und γ-Glykoproteinen erhöht und der Gehalt an Glykoproteinen in der Albuminfraktion verringert; Bei einem erheblichen Teil dieser Patienten ist auch die Diphenylamin-Reaktionsrate erhöht. Bei schwerer Zirrhose nimmt der Spiegel der Glykoproteinfraktionen von Albumin sowie der α1- und α2-Glykoproteine ab; mit zunehmender Menge an Glykoproteinen nimmt die Diphenylamin-Reaktionsgeschwindigkeit stark ab. Die größten Anstiege des Gehalts an α1- und α2-Glykoproteinen werden bei Leberkrebs beobachtet.
Bestimmung des Gesamtproteins in Serum/Plasma/Blut und anderen biologischen Flüssigkeiten.
Alle bekannten Methoden zur Bestimmung der Konzentration des Gesamtproteins im Blutserum lassen sich in folgende Hauptgruppen einteilen:
1.Azotometrische Methode, basierend auf der Bestimmung der Proteinstickstoffmenge – die Kjeldahl-Methode und ihre Modifikationen.
2.Methoden zur Bestimmung der Serumdichte sind ungenau, weil Die Dichte hängt nicht nur vom Proteingehalt ab.
3. Wiegen – Blutserumproteine werden ausgefällt, bis zur Gewichtskonstanz getrocknet und auf einer Analysenwaage gewogen. Die Methoden sind arbeitsintensiv und erfordern große Mengen an Serum.
4. Refraktometrie – nicht perfekt, weil Ein Teil der Brechung wird durch andere Bestandteile des Serums bestimmt.
5. Kolorimetrisch – am gebräuchlichsten ist die einheitliche Biuret-Methode.
6. Andere Methoden – nephelometrische, polarimetrische, spektrophotometrische – sind nicht weit verbreitet.
Die heimische Industrie hat mit der Produktion von Kits zur Untersuchung der Konzentration des Gesamtproteins im Blutserum mithilfe der Biuret-Reaktion begonnen. Das gleiche Prinzip wird zur Messung des Gesamtproteingehalts in biologischen Flüssigkeiten mithilfe von Reagenzien verschiedener Unternehmen verwendet.
Bestimmung des Gesamtproteins im Blutserum mittels Biuret-Reaktion.
Reagenzien.
1,0,9 % Natriumchloridlösung /0,9 g Natriumchlorid pro 100 ml destilliertes Wasser/.
2,0,2 N Natriumhydroxidlösung, frei von Kohlendioxid / 20 ml 1 N Natriumhydroxid werden mit kochendem destilliertem Wasser auf 100 ml gebracht/.
3. Biuret-Reagenz: 4,5 g Rochelle-Salz werden in 40 ml 0,2 N Natriumhydroxidlösung gelöst, dann werden 1,5 g Kupfersulfat und 0,5 g Natriumhydroxid zugegeben. In einem dunklen Glasbehälter aufbewahren, die Lösung ist stabil.
4,0,5 % Kaliumiodidlösung in 0,2 N Natriumhydroxidlösung.
5. Arbeitslösung des Biuret-Reagenz: 20 ml Biuret-Reagenz werden mit 80 ml Kaliumiodidlösung gemischt. Rack-Lösung.
6. Standardalbuminlösung aus menschlichem oder Rinderserum: 10 % Albuminlösung in 0,9 % Natriumchloridlösung / 1 ml Lösung enthält 0,1 g Protein – 100 g/l/.
Prinzip der Methode.
Proteine reagieren in alkalischem Medium mit Kupfersulfat zu violett gefärbten Verbindungen (Biuret-Reaktion).
Bestimmungsverfahren: 0,1 ml Serum zu 5 ml Arbeitslösung des Biuret-Reagenzes hinzufügen und mischen, dabei Schaumbildung vermeiden. Nach 30 Minuten \und spätestens einer Stunde\ wird auf FEC in einer Küvette mit einer Schichtdicke von 1 cm bei einer Wellenlänge von 540-560 nm \Grünlichtfilter\ gegen die Kontrolle gemessen.
Kontrolle: 0,1 ml 0,9 %ige Natriumchloridlösung werden zu 5 ml der Arbeitslösung des Biuret-Reagens gegeben und dann experimentell verarbeitet.
Die Berechnung erfolgt gemäß Kalibrierplan.
Normalwerte für Gesamtprotein liegen bei 65-85 g/l.
Erstellung eines Kalibrierdiagramms.
Reagens: Standardlösung von Albumin 10 % in 0,9 % Natriumchloridlösung, 1 ml davon enthält 0,1 g Protein. Zur Herstellung des Reagenzes können Sie lyophilisiertes Albumin aus dem „Bilirubin-Standard“-Kit von Lachem verwenden. Die Packungsanleitung gibt den Albumingehalt in mg an. Auf dieser Grundlage berechnen wir, wie viel 0,9 % Natriumchlorid zu einem bestimmten Albumin hinzugefügt werden muss, um 0,1 g Protein in 1 ml Lösung zu erhalten.
Zum Beispiel: Aus der Packungsanleitung geht hervor, dass lyophilisiertes Albumin 160 mg Albumin enthält. Berechnung: Eine 10 %ige Standardlösung enthält 10 g oder 10.000 mg pro 100 ml
im Standard 160 mg in X
X = 1,6 ml, d.h. Geben Sie 1,6 ml 0,9 %iges Natriumchlorid in die Flasche mit Albumin und stellen Sie fest, dass 1 ml dieser Lösung 0,1 g Protein enthält.
Nach der Herstellung der Standardlösung bereiten wir daraus eine Reihe von Arbeitsverdünnungen gemäß der Tabelle vor:
Berechnung der Proteinkonzentration in g/l.
1 ml 10 %ige Standardlösung enthält 0,1 g Protein
0,04 g Protein sind in 1 ml Lösung enthalten
X in 1.000 ml
Von jeder Arbeitsverdünnung der entsprechenden Konzentration 0,1 ml in 3-4 Reagenzgläser geben, d.h. Jede Bestimmung wird in 3-4 Parallelen durchgeführt und jedem Reagenzglas werden 5 ml Biuret-Reagenz zugesetzt. Nach 30–60 Minuten kolorimetrisch auf FEC im Vergleich zur Kontrolle. Für jede Konzentration erhalten wir 3-4 Messwerte der optischen Dichte. Daraus ermitteln wir das arithmetische Mittel, nachdem wir stark abweichende Messwerte zuvor verworfen haben.
Wir erstellen eine Kalibrierungskurve: Auf der Abszissenachse tragen wir die Proteinkonzentration in g/l auf, d. h. 40-60-80-100g\l; und entlang der Ordinate sind die Messwerte der optischen Dichte aufgetragen, die beim FEC \arithmetischen Mittel/ erhalten wurden.
Die Kalibrierungskurve sollte wie eine durch drei Punkte gezogene Primalinie aussehen. Diese Kurve wird an Spenderseren getestet (mindestens 3-4 Bestimmungen). Beim Erhalt normaler Proteinwerte, d. h. innerhalb der normalen Grenzen; Die erstellte Kalibrierungskurve wird in der Arbeit verwendet.
Notiz.
1. Die Kalibrierungskurve muss mindestens einmal im Jahr sowie jedes Mal nach einer Reparatur und auf einem neu erhaltenen fotoelektrischen Kolorimeter erstellt werden.
2. Der lineare Zusammenhang zwischen optischer Dichte und Konzentration bleibt bis zu D=0,5 erhalten. Enthält die Molke eine größere Menge Protein, wird die Molke mit Natriumchlorid auf die Hälfte verdünnt.
Bestimmung von Harnstoff in Blut und Urin.
Harnstoff ist das wichtigste stickstoffhaltige Produkt des Proteinkatabolismus.
Beim Abbau von Proteinen reichert sich Ammoniak an, eine giftige Substanz. Der wichtigste Weg zur Neutralisierung von Ammoniak ist die Synthese von Harnstoff in der Leber. Die Konzentration von Harnstoff im Blut hängt von der Geschwindigkeit seiner Bildung in der Leber und seiner Ausscheidung aus dem Körper über die Nieren im Urin ab.
Bei den meisten Patienten spiegelt die Geschwindigkeit der Harnstoffbildung die Geschwindigkeit der zellulären Proteinverwertung und des Proteinabbaus wider.
Bei schwerer Lebererkrankung ist die Fähigkeit der Hepatozyten zur Harnstoffsynthese beeinträchtigt, Ammoniak reichert sich an und der Harnstoffgehalt im Blut nimmt ab.
Die Entfernung des entstehenden Harnstoffs erfolgt im Urin und hängt von der Ausscheidungsfunktion der Nieren ab.
Die Harnstoffbestimmung erfolgt nach folgenden Methoden:
1. Chemische Methode zur Farbreaktion mit Diacetylmonoxim.
2. Enzymatische Methode (Urease)
3. Methode „Trockenchemie“.
Bestimmung von Harnstoff durch Reaktion mit Diacetylmonoxim.
Reagenzien.
1.Diacetylmonoxim und Thiosemicarbazid oder Reagenz in Tablettenform.
2. Referenz- oder Standardlösung mit 100 mg Harnstoff in 100 ml oder 1 mg in 1 ml.
Vorbereitung von Lösungen.
Reagenzlösung: 1 Tablette unter Erhitzen in einem 50-ml-Messkolben in 30 ml destilliertem Wasser auflösen. Nach dem Abkühlen das Volumen auf die Marke bringen. Die Lösung ist mehrere Wochen stabil.
Schwefelsäurelösung: 150 ml destilliertes Wasser und 25 ml 96 %ige Schwefelsäure in Analysequalität in einen 250-ml-Messkolben geben. Nach dem Abkühlen erhitzen und das Volumen auf die Marke bringen. Die Lösung ist stabil.
Vor der Reaktion wird eine Arbeitslösung aus Reagenz und Schwefelsäure im Verhältnis 1:1 hergestellt (siehe Definitionsdiagramm).
Prinzip der Methode.
Harnstoff bildet mit Diacetylmonoxim in Gegenwart von Thiosemicarbazid und Eisensalzen in stark saurer Umgebung einen roten Komplex; die Farbintensität ist proportional zur Harnstoffkonzentration.
Fortschritt der Bestimmung.
Reagenzien Experience Control Standard
1.Serum 0,02 - -
2. Arbeitslösung
a\Reagenzlösung 2,0 2,0 2,0
b\Schwefellösung
Säuren 2,0 2,0 2,0
3.Standardgröße
Harnstoff - - 0,02
10 Minuten in einem kochenden Wasserbad einweichen. 2-3 Minuten unter fließendem kaltem Wasser abkühlen lassen. Kolorimeter spätestens nach 15 Minuten: Grünfilter \bei Wellenlänge 490-540\, Küvette 1 cm, Gegenkontrolle.
Berechnung: Vor
X= -------- * C st in mmol\l, wobei
Do – optische Dichte des Experiments;
Dst – optische Dichte einer Standard-Harnstofflösung oder eines Standards;
Cst ist die Harnstoffkonzentration in der Standardlösung;
X ist die Harnstoffkonzentration in der Serumprobe.
Um mg% in mmol\l umzurechnen, wird ein Koeffizient von 0,1665 verwendet.
Normale Harnstoffwerte im Blutserum liegen bei 2,5 – 8,3 mmol/l.
Anmerkungen
1. Das obige Bestimmungsverfahren kann modifiziert werden, indem die Volumina aller gemessenen Lösungen je nach Küvettenvolumen um das 2- bis 3-fache erhöht werden.
3. Die Umrechnung der Harnstoffwerte in Harnstoffstickstoff kann durch Multiplikation mit dem Faktor 0,466 erfolgen.
4. Thiosemicarbazid ist ein toxisches Reagenz. Bei der Arbeit damit müssen Sie die Regeln für den Umgang mit giftigen Stoffen beachten.
Zur Beurteilung des Zustands des Proteinstoffwechsels sowie der Funktionen einzelner Organe wird die Bestimmung des Gesamtproteins und seiner Fraktionen, Harnstoff, Kreatinin und anderer Bestandteile des Reststickstoffs im Blutserum durchgeführt.
Zur Bestimmung des Gesamtproteins des Blutserums werden Verbrennungsmethoden (kjeldalemetrisch), refraktometrische, spektrophotometrische usw. verwendet. In veterinärmedizinischen Labors werden hauptsächlich refraktometrische und kolorimetrische (Biuret) Methoden verwendet. Bei der Bestimmung von Proteinfraktionen im Blutserum kommen elektrophoretische (auf Agargel, in Polyacrylamidgel, auf Papier, Celluloseacetat), turbidimetrische (Aussalzen mit Neutralsalzen), Sedimentationsmethoden (Trennung von Proteinen in Fraktionen durch Ultrazentrifugation) usw. zum Einsatz .
In der klinischen Praxis werden zur Proteintrennung häufiger elektrophoretische und turbidimetrische Methoden eingesetzt. Bei der Elektrophorese auf Papier werden 5 Hauptfraktionen gewonnen: Albumin, ap, (X2, P- und 7-Globuline. Die Nachteile dieser Methode sind die Dauer der Analyse (Forschungsergebnisse können erst am 2.-3. Tag erhalten werden) , nicht sehr klare Trennung der Proteinfraktionen. Durch Elektrophorese auf einem Agargel wird eine klarere Trennung der Proteinfraktionen als auf Papier erreicht, die Komplexität des Gelherstellungsverfahrens erlaubt jedoch keine breite Einführung dieser Methode in die Laborpraxis. Mittels Elektrophorese auf einem Polyacrylamidgel können etwa 30 Proteinfraktionen gewonnen werden. Der Nachteil der Methode ist die Schwierigkeit der quantitativen Auswertung der gewonnenen Fraktionen.
Die Methode der Elektrophorese auf Celluloseacetat gilt als einheitlich. In Ermangelung eines Elektrophoresegeräts im Labor werden Methoden zur Ausfällung von Proteinen mit neutralen Salzen verwendet, gefolgt von einer turbidimetrischen Messung des Trübungsgrads des Mediums auf einem FEC. Das Verhältnis von Albuminen und Globulinen im Blutserum wird durch Protein-Sediment-Tests (Sublimat, mit Zinksulfat, Thymol etc.) bestimmt.
Unter Reststickstoff versteht man die Menge an Stickstoff, die nach der Proteinfällung im Blut verbleibt. Dazu gehören Stickstoff aus Harnstoff, Aminosäuren, Kreatinin, Kreatin, Harnsäure, Indican, Ammoniak, Polypeptide, Nukleotide, biogene Amine und andere Produkte des Proteinstoffwechsels. Der Hauptteil des restlichen Blutstickstoffs ist Harnstoffstickstoff, der mindestens die Hälfte des gesamten Nichtproteinstickstoffs im Blut ausmacht.
Etwa 1/4 des Reststickstoffs ist Stickstoff aus Aminosäuren, Kreatin und Kreatinin. Von größter klinischer Bedeutung ist die Bestimmung einzelner Reststickstofffraktionen, insbesondere Harnstoff, Aminstickstoff, Kreatin und Kreatinin, Harnsäure und Indican.
Zur Bestimmung von Harnstoff in Blut, Urin und anderen biologischen Flüssigkeiten werden Diacetylmonoxim, Urease, Hypochlorit, Hypobromid, Xanthhydrol und andere Methoden verwendet. Am gebräuchlichsten ist die kolorimetrische Methode, die auf der Wechselwirkung von Harnstoff mit Diacetylmonoxim zur Bildung farbiger Produkte (Firon-Reaktion) basiert. Allerdings sind Methoden zur Harnstoffbestimmung mithilfe des Enzyms Urease genauer und spezifischer.
Zur Bestimmung von Protein, Albumin, Harnstoff, Kreatinin sowie anderen biochemischen Indikatoren können Reflexionsphotometer und Diagnosestreifen des „Trockenchemie“-Systems sowie biochemische Autoanalysatoren verwendet werden. Blutentnahmeröhrchen sollten keine Reinigungsmittel oder andere Reinigungsmittel enthalten. Halten Sie sie geschlossen.
Mehr zum Thema METHODEN ZUR BEWERTUNG DES ZUSTANDS DES PROTEINSTOFFWECHSELS:
- METHODEN ZUR BEURTEILUNG DES ZUSTANDS DES WASSER-ELEKTROLYT- UND MINERALSTOFFWECHSELS
- ERKRANKUNGEN DES PROTEIN-, KOHLENHYDRAT- UND FETTSTOFFWECHSELS ADIPOSITAS
- Beurteilung des Zustands der Vegetationsbedeckung nach einem schweren Torfbrand
- Bestimmung von Proteinfraktionen im Blutserum nach der turbidimetrischen (nephelometrischen) Methode.
- ERFAHRUNG MIT DER QUANTITATIVEN BEWERTUNG DER DYNAMISCHEN BEDINGUNGEN UND DER STABILITÄT VON KIEFERPFLANZUNGEN AN HYDROMELIORATIONSOBJEKTEN